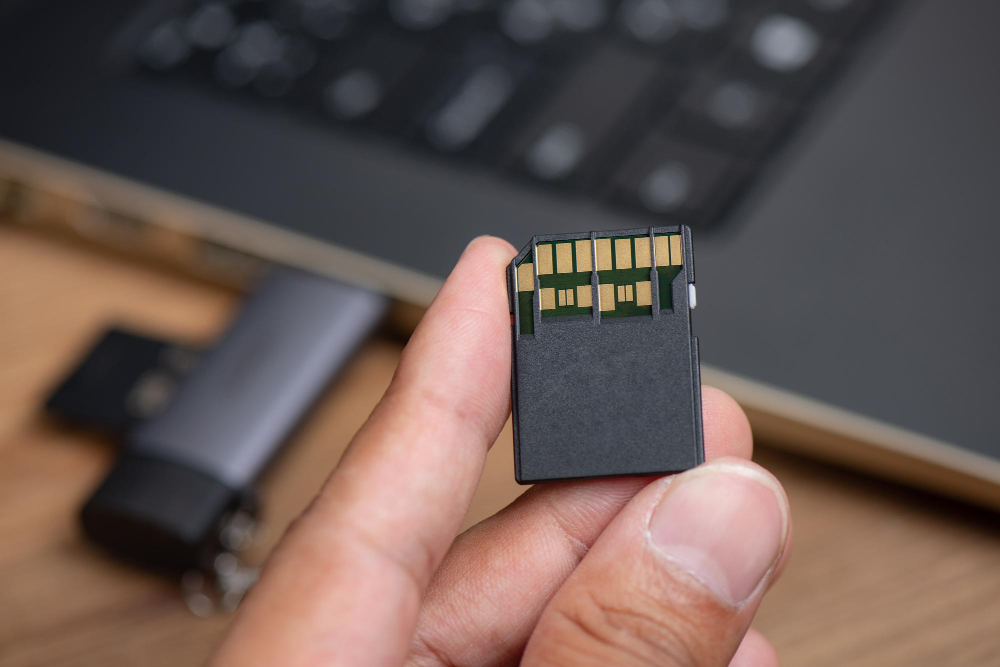Du stehst draußen in einer klaren Nacht, weit weg von der Stadt, der Himmel über dir ein funkelndes Meer aus Lichtpunkten. Ein Anblick, der einen demütig macht. Und dann kommt dieser Gedanke: „Das muss ich festhalten!“ Genau darum soll es hier gehen – wie du das Sternenhimmel fotografieren lernen kannst, ohne gleich ein Vermögen auszugeben oder Astrophysik studiert zu haben.
Raus aus der Stadt, rein ins nächtliche Abenteuer
Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Versuche. Ich stand irgendwo im Nirgendwo, es war stockfinster, nur meine Kamera und ich. Und natürlich tausende von Sternen. Ich drückte auf den Auslöser, voller Erwartung. Das Ergebnis? Ein schwarzes Bild. Oder ein graues, verrauschtes Etwas. Frustrierend? Und wie! Aber irgendwie hat mich dieser Ehrgeiz gepackt. Es muss doch möglich sein, diese unfassbare Schönheit einzufangen. Und ja, es ist möglich. Es braucht nur ein bisschen Wissen, die richtige Herangehensweise und vor allem Geduld. Vergiss erst mal die Hochglanzbilder aus Magazinen. Wir fangen klein an, Schritt für Schritt. Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern der Spaß am Ausprobieren und das Erfolgserlebnis, wenn das erste brauchbare Bild vom Sternenhimmel auf dem Display erscheint.
Was du wirklich brauchst – und was nicht
Gleich vorweg: Du musst nicht sofort dein Konto plündern, um den Sternenhimmel fotografieren zu können. Klar, Profi-Equipment macht vieles einfacher, aber für den Anfang reicht oft schon das, was du vielleicht schon hast oder dir für überschaubares Geld zulegen kannst. Eine Spiegelreflex- oder Systemkamera mit manuellen Einstellungsmöglichkeiten ist natürlich ideal. Je größer der Sensor, desto besser fängt er in der Regel Licht ein, was bei Nachtaufnahmen ein Vorteil ist. Aber hey, selbst mit modernen Smartphones kann man erstaunliche Ergebnisse erzielen – dazu später mehr.
Das allerwichtigste Werkzeug ist ein stabiles Stativ. Ich kann das nicht genug betonen. Bei den langen Belichtungszeiten, die wir brauchen, würde jede noch so kleine Bewegung das Bild ruinieren. Investiere hier lieber ein paar Euro mehr, ein wackeliges Billigstativ bringt nur Frust. Glaub mir, ich hab’s probiert.
Ein Weitwinkelobjektiv ist ebenfalls sehr empfehlenswert. Es fängt einen großen Himmelsausschnitt ein und lässt oft mehr Licht durch (erkennbar an einer kleinen Blendenzahl wie f/2.8 oder niedriger). Das Kit-Objektiv deiner Kamera geht für den Anfang auch, aber ein lichtstärkeres Weitwinkel wird dir das Leben leichter machen.
Was noch? Ein Fernauslöser (oder der Selbstauslöser deiner Kamera) verhindert Wackler beim Drücken des Auslöseknopfes. Eine Stirnlampe, am besten mit Rotlichtfunktion, ist Gold wert. Rotlicht stört deine Nachtsicht weniger als weißes Licht – du willst ja schließlich auch mit bloßem Auge was sehen und nicht ständig geblendet werden.
Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026 um 3:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.Und dann die Basics, die oft vergessen werden: Zieh dich warm an! Nächte können auch im Sommer empfindlich kalt werden, besonders wenn man stundenlang stillsteht. Pack dir eine Thermoskanne mit heißem Tee oder Kaffee ein. Und das Wichtigste: Bring Geduld mit. Möchtest du nämlich den perfekten Snapshot vom Sternenhimmel haben, brauchst du ordentlich Geduld!
Kleiner Helfer: Die Stirnlampe mit Rotlicht
Warum Rotlicht? Unsere Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit (Dunkeladaption). Weißes Licht, selbst von einer gedimmten Lampe, zerstört diese Anpassung sofort wieder. Rotlicht stört die Adaption deutlich weniger, sodass du deine Kamera bedienen und trotzdem den Sternenhimmel genießen kannst.
Planung: Der Schlüssel zum nächtlichen Erfolg
Einfach rausfahren und losknipsen? Kann man machen, führt aber selten zu den besten Ergebnissen. Ein bisschen Planung gehört dazu, wenn du den Sternenhimmel fotografieren willst.
Der wichtigste Faktor: Dunkelheit. Klingt banal, ist aber entscheidend. Stadtlichter, selbst aus Kilometern Entfernung, erzeugen einen Lichtsmog, der die feinen Sterne überstrahlt. Du musst also raus aus der Zivilisation. Wie dunkel es wo ist, verraten dir spezielle Karten oder Apps zur Lichtverschmutzung (Suchbegriff: Light Pollution Map). Such dir einen Ort mit möglichst wenig Umgebungslicht. Ein Feldweg, ein Hügel abseits von Dörfern, vielleicht sogar die Berge – je dunkler, desto besser. Beim Lichtverschmutzung vermeiden liegt oft der erste große Hebel für bessere Bilder.
Das Wetter muss natürlich auch mitspielen. Eine dichte Wolkendecke macht das Sternenhimmel fotografieren unmöglich. Check also unbedingt den Wetterbericht. Ideal sind klare, wolkenlose Nächte. Manchmal können ein paar Schleierwolken auch interessant wirken, aber für den Anfang ist ein klarer Himmel einfacher. Achte auch auf die Luftfeuchtigkeit – hohe Feuchtigkeit kann zu Dunst führen und die Sicht trüben.
Und dann ist da noch der Mond. Ein heller Vollmond ist zwar wunderschön anzusehen, überstrahlt aber gnadenlos die meisten Sterne. Dein bester Freund für die Astrofotografie ist der Neumond oder die Zeit kurz davor oder danach, wenn nur eine schmale Mondsichel am Himmel steht und früh untergeht. Es gibt zahlreiche Apps (wie PhotoPills, SkyView, Star Walk), die dir nicht nur die Mondphasen, sondern auch den Stand von Sternbildern und der Milchstraße anzeigen. Apropos Milchstraße: Wenn du gezielt die Milchstraße fotografieren möchtest, musst du wissen, wann ihr helles Zentrum über dem Horizont sichtbar ist. Das variiert je nach Jahreszeit und geografischer Lage. Im Sommerhalbjahr ist sie auf der Nordhalbkugel meist am besten zu sehen.
Hier eine kleine Checkliste für deine Planung:
- Such dir einen möglichst dunklen Ort – raus aus der Stadt, weg von Laternen. Lichtverschmutzungskarten helfen bei der Planung.
- Ein Blick aufs Wetter lohnt sich: klare, wolkenlose Nächte sind das A und O. Wind und Feuchtigkeit können ebenfalls stören.
- Die Mondphase hat großen Einfluss – bei Neumond ist es schön dunkel, beim Vollmond fast zu hell für gute Sicht.
- Nutz Apps, um zu wissen, was gerade am Himmel los ist. Wann ist die Milchstraße sichtbar? Welche Sternbilder lohnen sich?
- Sei lieber etwas früher vor Ort – im Hellen lässt sich das Equipment entspannter aufbauen und man findet sich besser zurecht.
Die richtigen Kameraeinstellungen für die Nachtfotografie
So, du stehst am perfekten Ort, der Himmel ist klar, das Stativ aufgebaut. Jetzt geht’s ans Eingemachte: die Kameraeinstellungen für Nachtfotografie. Hier gibt es kein Patentrezept, das immer funktioniert, aber gute Ausgangswerte, von denen du starten kannst. Vergiss den Automatikmodus deiner Kamera, der ist bei Nacht hoffnungslos überfordert. Wir brauchen volle Kontrolle, also ab in den manuellen Modus (M):
- Autofokus bringt bei Dunkelheit fast nichts – schalte deshalb auf manuellen Fokus (MF) um. Stell den Fokusring auf Unendlich, aber verlass dich nicht blind auf die Markierung. Lieber im Live-View den hellsten Stern suchen, digital reinzoomen und so lange feinjustieren, bis der Punkt richtig scharf ist.
- Öffne die Blende so weit wie möglich – je kleiner die Blendenzahl, desto mehr Licht. f/1.8, f/2.8 oder f/3.5 sind gute Startpunkte, je nachdem, was dein Objektiv hergibt.
- Lange Belichtungszeit? Ja – aber nicht zu lang. Die 500er-Regel hilft dir: 500 geteilt durch Brennweite (Vollformat) ergibt die maximale Belichtungsdauer, bevor die Sterne zu Strichen werden. Bei APS-C Kameras den Crop-Faktor mit einrechnen.
- Für Sternenlicht brauchst du einen relativ hohen ISO-Wert, meistens zwischen 1600 und 6400. Aber je höher der ISO, desto stärker das Rauschen – also: testen, vergleichen und den besten Kompromiss finden.
- Speichere die Bilder unbedingt im RAW-Format. Damit behältst du alle Bildinformationen und kannst später in der Bearbeitung viel mehr aus dem Bild herausholen als bei JPGs.
Hier eine Übersicht möglicher Start-Einstellungen zum Sternenhimmel fotografieren:
| Einstellung | Empfohlener Bereich | Warum? |
|---|---|---|
| Modus | Manuell (M) | Volle Kontrolle über alle Parameter. |
| Fokus | Manuell (MF) auf Unendlich (feinjustiert über Live-View) | Autofokus funktioniert bei Dunkelheit nicht zuverlässig. |
| Blende | Möglichst weit offen (kleinste f-Zahl, z.B. f/1.8 – f/4) | Maximalen Lichteinfall ermöglichen. |
| Belichtungszeit | 10 – 30 Sekunden (je nach Brennweite, 500er-Regel beachten) | Genug Licht sammeln, aber Sternspuren vermeiden. |
| ISO | 1600 – 6400 (oder höher, je nach Kamera und Rauschverhalten) | Signalverstärkung für schwaches Licht, Kompromiss mit Rauschen finden. |
| Dateiformat | RAW | Maximaler Spielraum für die Nachbearbeitung. |
| Weißabgleich | Manuell (ca. 3800-4500 Kelvin als Startpunkt, oder Tageslicht/Sonne) | Automatik oft unzuverlässig, nachträglich im RAW anpassbar. |
| Bildstabilisator | Ausgeschaltet (am Objektiv/in der Kamera) | Auf dem Stativ kann der Stabi versuchen, nicht vorhandene Bewegungen auszugleichen und so Unschärfe erzeugen. |
Mach immer wieder Testaufnahmen und kontrolliere das Ergebnis auf dem Kameradisplay (Histogramm prüfen!). Ist das Bild zu dunkel? Erhöhe die ISO oder verlängere die Belichtungszeit (Achtung Sternspuren!). Ist es zu hell? Reduziere ISO oder Belichtungszeit. Es ist ein Herantasten.
Geht das auch mit dem Smartphone? Sternenhimmel fotografieren für die Hosentasche
Nicht jeder hat gleich eine teure Kamera zur Hand. Die gute Nachricht: Auch mit dem Smartphone lässt sich der Sternenhimmel fotografieren – zumindest ansatzweise. Erwarte keine Wunder, die kleinen Sensoren und Objektive stoßen physikalisch an Grenzen. Aber für einen ersten Eindruck oder wenn du einfach mal spontan loslegen willst, ist es einen Versuch wert. Wichtig ist auch hier: Ein Stativ ist Pflicht! Es gibt kleine, günstige Smartphone-Stative. Ohne geht es nicht, da auch hier mit längeren Belichtungszeiten gearbeitet wird. Dein Smartphone sollte idealerweise einen „Pro-“ oder „Nachtmodus“ haben, der manuelle Einstellungen erlaubt. Wenn nicht, gibt es oft spezielle Kamera-Apps (z.B. ProCamera, Camera FV-5), die mehr Kontrolle ermöglichen.
Zuletzt aktualisiert am 16. Januar 2026 um 3:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.Suche nach Einstellungen für Belichtungszeit (so lang wie möglich, oft bis 10-30 Sekunden im Nachtmodus), ISO (nicht zu hoch, sonst rauscht es extrem, vielleicht 800-1600 probieren) und manuellem Fokus (auf unendlich stellen). Auch hier gilt: Ausprobieren! Manche High-End-Smartphones haben sogar spezielle Astrofotografie-Modi, die intern mehrere Aufnahmen kombinieren. Die Ergebnisse können überraschend gut sein, reichen aber meist nicht an die Detailfülle einer Systemkamera heran. Sieh es als Einstieg oder als Möglichkeit, den Moment festzuhalten, wenn gerade nichts anderes zur Hand ist.
Smartphone-Astrofotografie: Was ist realistisch?
Moderne Smartphones können dank ausgeklügelter Software (Computational Photography) oft erstaunlich viel aus dunklen Szenen herausholen. Du wirst wahrscheinlich keine gestochen scharfe Milchstraße mit feinsten Details einfangen, aber helle Sterne, Sternbilder und manchmal sogar einen Hauch der Milchstraße sind durchaus möglich. Für den Einstieg in das Sternenhimmel fotografieren reicht das oft völlig aus – und du bekommst ein Gefühl dafür, ob du mehr lernen willst.
Mehr als nur Punkte: Komposition am Nachthimmel
Ein Foto nur mit Sternen kann schnell etwas eintönig wirken. Richtig spannend wird es, wenn du den Himmel in einen Kontext setzt. Versuche, Elemente aus der Landschaft in dein Bild einzubeziehen. Das schafft Tiefe und erzählt eine Geschichte.
Mögliche Vordergrund-Elemente:
- Eine markante Baum-Silhouette gibt dem Sternenhimmel Tiefe und Struktur – besonders schön, wenn sie einzeln steht oder auffällig gewachsen ist.
- Berggipfel oder Hügelketten wirken im Gegenlicht der Sterne oft dramatisch – je nach Standort kannst du auch mit Konturen oder Fernsicht spielen.
- Ein altes Gebäude, eine Ruine oder eine Kapelle kann richtig stimmungsvoll wirken – aber Achtung: künstliches Licht in der Nähe kann das Bild stören oder überstrahlen.
- Ein See oder Fluss, in dem sich Sterne oder Milchstraße spiegeln, sorgt für eine besonders ruhige und magische Stimmung.
- Ein interessanter Felsen – vielleicht bizarr geformt oder auffällig im Gelände – bringt Spannung in die Bildkomposition, vor allem bei tiefer Kameraperspektive.
Denk an grundlegende Gestaltungsregeln wie den Goldenen Schnitt oder die Drittel-Regel. Platziere den Horizont nicht genau in der Mitte, sondern eher im unteren oder oberen Drittel. Nutze Linien im Vordergrund (ein Weg, ein Zaun), um den Blick des Betrachters ins Bild und zum Himmel zu führen.
Du kannst auch kreativ werden: Nimm dich selbst oder eine andere Person mit ins Bild (kurz mit einer Taschenlampe anleuchten oder als Silhouette). Oder versuche dich an Light Painting: Mit einer Taschenlampe während der langen Belichtung Formen oder Worte in die Luft „malen“. Das erfordert etwas Übung, kann aber tolle Effekte ergeben. Das Sternenhimmel fotografieren wird so zu einer kreativen Spielwiese.
Nachbearbeitung: Der letzte Schliff für deine Sternenfotos
Wie schon erwähnt, ist das Fotografieren im RAW-Format beim Sternenhimmel fotografieren eigentlich Pflicht. Diese Rohdaten sehen direkt aus der Kamera oft flau und unspektakulär aus. Erst in der Nachbearbeitung am Computer oder sogar am Smartphone/Tablet holst du das Beste aus ihnen heraus.
Keine Angst, du musst kein Photoshop-Guru sein. Programme wie Adobe Lightroom (gibt’s auch als mobile App), Darktable (kostenlos), Luminar Neo oder sogar Snapseed (mobile App, kostenlos) bieten die nötigen Werkzeuge.
Was solltest du anpassen?
- Achte beim Weißabgleich darauf, Farbstiche zu entfernen – der Himmel sollte nicht grünlich oder lila schimmern, sondern eher neutral bläulich oder tiefschwarz wirken.
- Helle die Sterne leicht auf und sorge für einen deutlichen Kontrast zwischen Himmel und Sternen – so wirkt das Bild lebendiger, ohne unnatürlich zu sein.
- Wenn du mit Lichtern und Tiefen spielst, kannst du Details aus den hellsten Sternen zurückholen und gleichzeitig dunkle Bildbereiche etwas anheben – besonders im Vordergrund kann das Wunder wirken.
- Ein bisschen mehr Klarheit oder Struktur kann helfen, die Sterne knackiger erscheinen zu lassen – aber Vorsicht: Zu viel davon sieht schnell übertrieben aus.
- Eine sanfte Schärfung ist oft sinnvoll, um die Sterne klarer hervorzuheben, gerade bei leicht weichen Aufnahmen.
- Fast immer nötig: Rauschreduzierung bei hoher ISO. Gute Software holt hier viel raus, aber wenn du’s übertreibst, verschwinden leider auch die feinen Sternchen.
Ziel der Nachbearbeitung sollte es sein, das Bild so zu optimieren, wie du die Szene vielleicht mit bloßem Auge (oder besser) wahrgenommen hast, aber ohne es unnatürlich wirken zu lassen. Es ist ein Balanceakt. Experimentiere mit den Reglern und schau, was passiert. Oft hilft es, das bearbeitete Bild mal einen Tag liegen zu lassen und dann mit frischem Blick erneut zu beurteilen.
Typische Fehler und wie du sie vermeidest
Beim Sternenhimmel fotografieren läuft nicht immer alles glatt. Hier sind ein paar häufige Probleme und Lösungsansätze:
| Problem | Mögliche Ursache(n) | Lösungsansatz |
|---|---|---|
| Unscharfe Sterne | Fokus nicht exakt getroffen; Verwackelt (Stativ instabil, Wind, Auslösen per Hand); Bildstabilisator an | Fokus sorgfältig manuell über Live-View einstellen; Stabiles Stativ verwenden, evtl. beschweren; Fernauslöser/Selbstauslöser nutzen; Bildstabilisator ausschalten. |
| Sterne als Striche (Sternspuren) | Belichtungszeit zu lang für die verwendete Brennweite. | Belichtungszeit verkürzen (500er-Regel beachten); Evtl. ISO erhöhen, um kürzere Zeit zu kompensieren. |
| Bild stark verrauscht | ISO-Wert zu hoch eingestellt; Sensor der Kamera klein/alt; Unterbelichtet und in der Nachbearbeitung stark aufgehellt. | ISO-Wert reduzieren (evtl. länger belichten, wenn möglich); Bessere Kamera verwenden (größerer Sensor); Korrekt belichten (Histogramm prüfen); Rauschreduzierung in der Nachbearbeitung (vorsichtig!). |
| Bild zu dunkel | Unterbelichtet (Blende zu klein, Belichtungszeit zu kurz, ISO zu niedrig). | Blende weiter öffnen; Belichtungszeit verlängern (Achtung Sternspuren!); ISO erhöhen. |
| Bild zu hell / Ausgebrannte Lichter | Überbelichtet (Blende zu weit offen, Belichtungszeit zu lang, ISO zu hoch); Starke Lichtverschmutzung. | ISO reduzieren; Belichtungszeit verkürzen; Blende leicht schließen (wenn möglich); Dunkleren Ort aufsuchen. |
| Seltsame Farben / Farbstich | Weißabgleich falsch eingestellt (oder auf Automatik); Lichtverschmutzung erzeugt Farbschleier (oft orange/gelb). | Weißabgleich manuell einstellen (Kelvin-Wert) oder nachträglich im RAW korrigieren; Nachbearbeitung zur Reduzierung von Lichtverschmutzungsfarben. |
| Beschlagenes Objektiv | Hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschied zwischen Ausrüstung und Umgebungsluft (Tau). | Objektiv langsam an Umgebungstemperatur anpassen; Taukappe verwenden; Objektivheizung (spezielle Heizmanschetten oder Handwärmer). |
Lass dich von anfänglichen Schwierigkeiten nicht entmutigen. Jeder Astrofotograf hat klein angefangen und ähnliche Probleme gehabt. Sehen es sportlich, lerne aus den Fehlern und probiere es beim nächsten Mal besser zu machen.
Mehr als nur Technik: Die Freude am Sternenhimmel
Am Ende ist das Sternenhimmel fotografieren viel mehr als nur Technik und Einstellungen. Es ist das Erlebnis, draußen in der Stille der Nacht zu sein, die Weite des Universums über sich zu spüren und zu versuchen, einen kleinen Teil davon einzufangen. Es entschleunigt ungemein. Manchmal ist das schönste Foto nicht das technisch perfekte, sondern das, welches die besondere Atmosphäre dieser Nächte transportiert.
Geh raus, probier es aus, experimentiere. Nimm dir Zeit, schau nicht nur durch den Sucher, sondern auch einfach mal nach oben. Vielleicht entdeckst du eine Sternschnuppe (und hast sogar Glück, sie zufällig aufs Bild zu bekommen). Es ist eine Reise, und jedes Foto, egal wie „gut“ es technisch ist, ist ein Schritt auf diesem Weg. Also, schnapp dir deine Kamera (oder dein Smartphone), ein Stativ, warme Jacke und los geht’s! Der Sternenhimmel wartet. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du ja eine ganz neue Leidenschaft.
FAQs zum Thema Sternenhimmel fotografieren
Was genau ist ‚Stacking‘ und wie hilft es mir bei meinen Sternenfotos?
Stacking ist eine Technik, bei der du mehrere Aufnahmen vom exakt gleichen Himmelsausschnitt machst, meist direkt hintereinander mit identischen Einstellungen. Diese Einzelbilder werden dann später am Computer mit einer speziellen Software übereinandergelegt und verrechnet. Der große Vorteil dabei ist die Rauschreduzierung, denn das unerwünschte Bildrauschen ist in jedem Bild zufällig verteilt, während die Sterne (das Signal) konstant bleiben. Durch das Verrechnen mittelt sich das Rauschen heraus, und das Signal der Sterne wird verstärkt, wodurch du deutlich sauberere und detailreichere Bilder erhältst. Es ist sozusagen ein Weg, die Signalqualität zu erhöhen, ohne die ISO zu weit aufdrehen oder unrealistisch lange belichten zu müssen.
Wie beleuchte ich den Vordergrund, ohne den Sternenhimmel zu überstrahlen?
Das ist tatsächlich eine kleine Kunst, aber gut machbar, wenn du behutsam vorgehst. Du möchtest ja nur einen Hauch von Licht auf den Vordergrund bringen, um ihm Struktur zu geben. Eine gute Methode ist es, während der langen Belichtungszeit für den Himmel den Vordergrund ganz kurz und aus einiger Entfernung mit einer schwachen Lichtquelle anzuleuchten. Dafür eignet sich zum Beispiel eine stark gedimmte LED-Taschenlampe, vielleicht sogar mit einem warmen Farbfilter, oder kurz das Display deines Handys auf niedrigster Helligkeit. Manchmal reicht schon ein kurzer Schwenk mit der Lampe für wenige Sekunden; hier musst du einfach etwas experimentieren, bis das Verhältnis zwischen Vordergrundhelligkeit und Sternenhimmel passt. Achte aber darauf, nicht direkt in die Kamera zu leuchten und das Licht eher seitlich oder von oben auf das Objekt fallen zu lassen.
Verändert sich die Sichtbarkeit der Milchstraße im Laufe der Nacht oder des Jahres?
Ja, absolut, die Milchstraße ist nicht die ganze Nacht oder das ganze Jahr über gleich gut zu sehen. Ähnlich wie Sonne und Mond bewegt sie sich durch die Erdrotation scheinbar über den Himmel, geht also an einer Seite auf und an der anderen unter. Je nach Jahreszeit ändert sich zudem, welcher Teil der Milchstraße sichtbar ist und zu welcher Uhrzeit ihr hellstes Zentrum (der galaktische Kern) am höchsten steht. Auf der Nordhalbkugel ist beispielsweise das eindrucksvolle Zentrum vor allem in den Sommernächten gut zu beobachten, während im Winter andere, etwas dezentere Arme der Milchstraße dominieren. Deshalb ist es so wichtig, Apps oder Planetariumsprogramme zu nutzen, die dir genau anzeigen, wann und wo die Milchstraße für deinen Standort und dein Wunschdatum am besten positioniert ist.
Mein Akku macht bei Kälte schnell schlapp – was kann ich dagegen tun?
Das ist ein sehr bekanntes Problem, denn Kälte reduziert die chemische Leistungsfähigkeit von Akkus erheblich. Die beste Strategie ist es, immer mindestens einen, besser zwei voll geladene Ersatzakkus dabeizuhaben. Diese bewahrst du nicht in der kalten Kameratasche auf, sondern möglichst nah am Körper, zum Beispiel in deiner Hosentasche oder einer inneren Jackentasche, damit sie warm bleiben. Wechsle den Akku in der Kamera erst dann, wenn er wirklich zur Neige geht, und ersetze ihn durch einen der vorgewärmten Ersatzakkus. Zusätzlich kannst du Strom sparen, indem du das Kameradisplay nur zur Kontrolle kurz einschaltest und die Helligkeit reduzierst; auch die Nutzung des Live-Views solltest du minimieren. Bei manchen Kameras gibt es zudem die Möglichkeit, eine externe Stromversorgung über eine Powerbank und einen Akku-Dummy zu nutzen, was bei sehr langen Sessions oder großer Kälte hilfreich sein kann.
„`
terms: Kreatives Gestalten & DIY