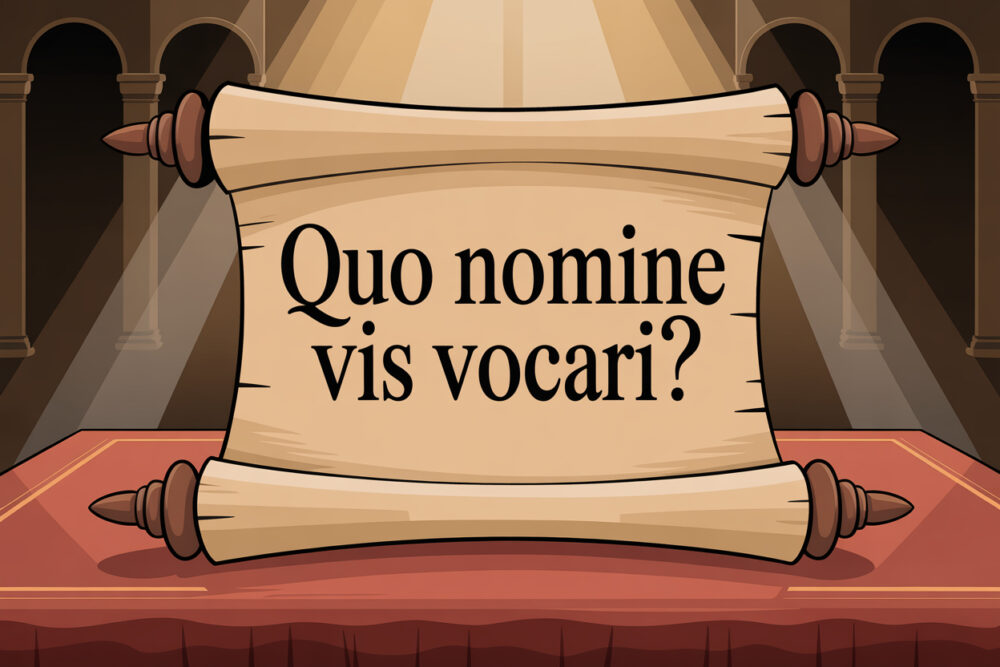Wenn weißer Rauch über dem Vatikan aufsteigt, hält die Welt für einen Moment den Atem an. Ein neues Oberhaupt der katholischen Kirche ist gewählt. Doch bevor sein bürgerlicher Name und der dann neue päpstliche Name der Öffentlichkeit verkündet werden, spielt die Namenswahl bei der Papstwahl eine ganz entscheidende, symbolträchtige Rolle – ein Akt, der tief in Tradition verwurzelt ist und oft schon erste Hinweise auf den Kurs des neuen Pontifex gibt.
Warum überhaupt ein neuer Name nach der Papstwahl?
Stell dir mal vor, du wirst in das höchste Amt der katholischen Kirche gewählt – ein Moment, der dein Leben von einer Sekunde auf die andere komplett umkrempelt. Und eine der ersten Fragen, die dir nach der Annahme der Wahl gestellt wird, ist: „Welchen Namen wählst du?“ Das ist schon eine ziemlich direkte Ansage, oder? Die Namenswahl bei der Papstwahl ist eben kein trivialer Akt, kein bloßes Umbenennen aus einer Laune heraus. Es ist vielmehr eine Tradition mit tiefen Wurzeln und einer starken symbolischen Bedeutung.
Der Brauch, dass ein neugewählter Papst einen neuen Namen annimmt, ist nicht so alt wie das Papsttum selbst, aber immerhin schon über tausend Jahre. Man sagt, Papst Johannes II. im Jahr 533 sei der erste gewesen. Sein Geburtsname war Mercurius, und als Heidegott-Name erschien ihm das wohl nicht ganz passend für den Stuhl Petri. Das ist zumindest eine gängige Erklärung. Ob’s stimmt? Wer weiß das heute schon so genau. Fakt ist aber, dass sich diese Sitte durchsetzte. Es wurde zu einem Zeichen des Neubeginns, des Ablegens der alten Identität und des Hineinwachsens in eine neue, universale Rolle. Man könnte es vergleichen mit dem Eintritt in einen Orden, wo Mönche und Nonnen ja auch oft einen neuen Namen erhalten. Es signalisiert: Ich bin jetzt nicht mehr nur Kardinal XY aus jenem Land, sondern Diener aller Gläubigen. Die Namenswahl bei der Papstwahl markiert also einen bewussten Bruch und gleichzeitig eine Kontinuität.
Manchmal steckt dahinter auch der Wunsch, einen als „unglücklich“ geltenden Namen abzulegen oder einen Namen zu wählen, der eine bestimmte programmatische Ausrichtung signalisiert. Denk mal an Papst Franziskus. Seine Wahl des Namens war ein klares Statement, eine Verbeugung vor Franz von Assisi, dem Heiligen der Armen und des Friedens. Das war eine Botschaft, die sofort verstanden wurde, noch bevor er sein erstes Wort als Papst gesprochen hatte.
Der Moment der Entscheidung
Direkt nachdem ein Kandidat im Konklave die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht hat, wird er vom Kardinaldekan gefragt, ob er die Wahl annimmt. Bejaht er dies, folgt unmittelbar die Frage: „Quo nomine vis vocari?“ – „Mit welchem Namen willst du gerufen werden?“[1] Eine Antwort muss dann parat sein.
Die Gründe für die Namenswahl bei der Papstwahl sind also vielfältig: Es geht um Tradition, um das Signal eines Neubeginns, um die Verbindung zu Vorbildern oder um die Ankündigung eines bestimmten pastoralen Programms. Es ist eine der ersten Amtshandlungen und eine, die sofort weltweit Beachtung findet.
Die Symbolik hinter der Namenswahl bei der Papstwahl
Jeder Name trägt eine Geschichte, eine Bedeutung. Und wenn ein frisch gewählter Papst seinen Namen bekannt gibt, dann ist das wie das Öffnen eines Buches, das erste Kapitel seines Pontifikats. Die Namenswahl bei der Papstwahl ist also ein hochsymbolischer Akt, der von Beobachtern und Gläubigen gleichermaßen interpretiert wird.
Einige Päpste wählen Namen, um ihre Verehrung für einen bestimmten Heiligen auszudrücken. Andere ehren einen direkten Vorgänger, dessen Werk sie fortsetzen möchten. Benedikt XVI. zum Beispiel wählte seinen Namen in Anlehnung an Benedikt XV., einen Friedenspapst während des Ersten Weltkriegs, und an den heiligen Benedikt von Nursia, den Vater des abendländischen Mönchtums und Schutzpatron Europas. Damit setzte er klare Akzente für sein Pontifikat: Dialog, Frieden und die christlichen Wurzeln Europas.[1]
Manchmal ist es auch eine Kombination aus verschiedenen Motiven. Johannes Paul I. etwa wählte einen Doppelnamen – eine absolute Neuheit damals – um seine Vorgänger Johannes XXIII. und Paul VI. zu ehren und deren Reformkurs des Zweiten Vatikanischen Konzils fortzuführen. Sein früher Tod nach nur 33 Tagen im Amt war tragisch, aber sein Nachfolger, Johannes Paul II., griff diesen Namen auf und machte ihn zu einem der bekanntesten Papstnamen der Geschichte. Die Namenswahl bei der Papstwahl ist hier ein Beispiel für Kontinuität und das Aufgreifen eines Vermächtnisses.
Es gibt auch Namen, die eher selten oder sogar noch nie gewählt wurden. Die Wahl des Namens Franziskus durch Jorge Mario Bergoglio war so ein Fall. Es war das erste Mal, dass ein Papst diesen Namen wählte. Und wie schon gesagt, die Verbindung zu Franz von Assisi – Bescheidenheit, Armut, Sorge um die Schöpfung – war sofort offensichtlich und prägt sein Pontifikat bis heute. Manchmal ist also gerade die unkonventionelle Namenswahl ein besonders starkes Signal.
Typische Beweggründe für die Wahl eines Papstnamens
Die folgenden Beweggründe können bei der Namenswahl eine Rolle spielen:
- Die Verehrung eines bestimmten Heiligen, dessen Tugenden als Vorbild dienen sollen.
- Die Ehrung eines oder mehrerer direkter Vorgänger, um eine programmatische Kontinuität zu signalisieren.
- Ein persönliches spirituelles Erlebnis oder eine besondere Verbindung zu einem Namenspatron.
- Der Wunsch, ein bestimmtes Thema oder Anliegen in den Mittelpunkt des Pontifikats zu stellen, wie Frieden, Einheit oder Barmherzigkeit.
- Das Abwägen, welche Botschaft der Name in die Welt und in die Kirche hinein sendet.
Letztlich ist es eine sehr persönliche Entscheidung des neuen Papstes, auch wenn er sich vielleicht mit Vertrauten berät. Aber die Last und die Ehre dieser ersten, wegweisenden Entscheidung liegt ganz bei ihm. Man darf gespannt sein, welche Überlegungen hinter der nächsten Namenswahl bei der Papstwahl stehen werden.
Beliebte Papstnamen und ihre Botschaften
Wenn man sich die lange Liste der Päpste anschaut, fallen bestimmte Namen immer wieder ins Auge. Johannes, Benedikt, Gregor, Clemens, Leo, Innozenz, Pius – das sind echte „Klassiker“ unter den Papstnamen. Jeder dieser Namen hat im Laufe der Kirchengeschichte eine eigene Färbung bekommen, eine Art historisches Gepäck, das mitschwingt, wenn er neu gewählt wird. Die Namenswahl bei der Papstwahl ist also auch ein Spiel mit diesen Konnotationen.
Der Name Petrus wurde, mit einer umstrittenen Ausnahme in der Frühzeit, nie wieder von einem Papst angenommen. Die Ehrfurcht vor dem ersten Apostel und Felsen der Kirche ist da wohl einfach zu groß. Wer würde sich schon anmaßen, sich direkt in seine Nachfolge zu stellen, indem er denselben Namen trägt? Eine interessante, ungeschriebene Regel.
Johannes ist der häufigste Papstname, gefolgt von Gregor und Benedikt. Diese Namen stehen oft für eine bestimmte Tradition. Ein „Johannes“ könnte an Johannes den Täufer, den Evangelisten Johannes oder an Johannes XXIII. erinnern, den „Konzilspapst“. Ein „Benedikt“ weckt Assoziationen an den Gründer des abendländischen Mönchtums. Ein „Pius“ hingegen lässt viele an eine eher konservative, traditionsbewusste Linie denken, wie sie etwa Pius IX. oder Pius XII. vertraten.
Interessant ist auch die Wahl von Leo XIV. für Kardinal Robert Prevost, wie es im Artikel der Tagesschau beschrieben wird.[2] Prevost, ein US-Amerikaner, der lange in Peru tätig war, galt als „Mann der Mitte und internationalen Zusammenarbeit“. Der Name Leo könnte auf Leo den Großen verweisen, einen bedeutenden Kirchenlehrer, oder auf Leo XIII., der für seine Sozialenzykliken bekannt ist. Die Wahl signalisiert oft eine Richtung.
Beispiele für Papstnamen im 20. und 21. Jahrhundert
Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele von Päpsten des 20. und 21. Jahrhunderts, ihre bürgerlichen Namen und ihre Papstnamen, was die Tradition der Namenswahl bei der Papstwahl verdeutlicht:
| Bürgerlicher Name | Papstname | Pontifikat | Kurze Anmerkung zur Namenswahl (falls bekannt/interpretiert) |
|---|---|---|---|
| Giacomo della Chiesa | Benedikt XV. | 1914–1922 | Bezug auf Benedikt XIV. und den Hl. Benedikt; Friedensbemühungen. |
| Achille Ratti | Pius XI. | 1922–1939 | Fortführung der „Pius“-Linie; Motto „Pax Christi in regno Christi“. |
| Eugenio Pacelli | Pius XII. | 1939–1958 | Kontinuität zu Pius XI.; Pontifikat im Zweiten Weltkrieg. |
| Angelo Giuseppe Roncalli | Johannes XXIII. | 1958–1963 | Name seines Vaters und der Taufkirche; Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils. |
| Giovanni Battista Montini | Paul VI. | 1963–1978 | Verehrung des Apostels Paulus; Fortführung und Abschluss des Konzils. |
| Albino Luciani | Johannes Paul I. | 1978 | Ehrung seiner Vorgänger Johannes XXIII. und Paul VI. |
| Karol Wojtyła | Johannes Paul II. | 1978–2005 | Fortführung des Namens seines direkten Vorgängers. |
| Joseph Ratzinger | Benedikt XVI. | 2005–2013 | Bezug auf Benedikt XV. (Friedenspapst) und Hl. Benedikt von Nursia (Schutzpatron Europas).[1] |
| Jorge Mario Bergoglio | Franziskus | seit 2013 | Erstmals gewählter Name; Bezug auf Franz von Assisi (Armut, Frieden, Schöpfung). |
Man sieht also, die Namenswahl bei der Papstwahl ist selten zufällig. Sie ist oft eine wohlüberlegte Entscheidung, die auf Geschichte, Theologie und der persönlichen Vision des neuen Pontifex beruht. Und auch wenn manche Namen häufiger vorkommen, kann jeder Papst durch seine Persönlichkeit und sein Wirken dem Namen eine neue Nuance, eine neue Prägung geben.
Vom Rauchzeichen zur Verkündung: Der Name wird bekannt
Das Konklave ist ja an sich schon ein Ereignis voller Spannung und alter Rituale. Die Kardinäle sind in der Sixtinischen Kapelle eingeschlossen, „cum clave – mit Schlüssel“, wie es heißt, abgeschottet von der Außenwelt.[1] Und dann, nach den Wahlgängen, warten alle auf das eine Zeichen: den Rauch aus dem Schornstein. Ist er schwarz, geht die Wahl weiter. Ist er weiß, dann ist die Entscheidung gefallen: „Habemus Papam!“ – „Wir haben einen Papst!“
Aber bevor dieser berühmte Satz vom Balkon des Petersdoms erschallt, geschehen noch einige wichtige Dinge. Nachdem der Gewählte die Wahl angenommen und seinen Papstnamen genannt hat, wird er in die „Kammer der Tränen“ geführt. Dort legt er die weiße Soutane an, die in verschiedenen Größen bereitliegt. Es ist der Moment des Übergangs, der Verwandlung. Anschließend nimmt er das Gehorsamsversprechen der Kardinäle entgegen.[1] Erst dann ist der Weg frei für die öffentliche Bekanntmachung.
Der Kardinalprotodiakon tritt auf die Benediktionsloggia des Petersdoms und verkündet der wartenden Menge und der Weltöffentlichkeit mit der feierlichen Formel den Namen des Gewählten und welchen Namen er sich als Papst gegeben hat. Die genauen Worte sind: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum [Vorname des Gewählten], Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem [Nachname des Gewählten], qui sibi nomen imposuit [Papstname].“ Das ist der Augenblick, auf den alle gewartet haben. Die Namenswahl bei der Papstwahl wird hier offiziell und unumkehrbar.
Es ist schon ein Gänsehautmoment, wenn nach Tagen der Ungewissheit und des Spekulierens endlich der Name genannt wird. Und oft sagt dieser Name, wie wir gesehen haben, schon sehr viel aus. Er ist die erste Visitenkarte des neuen Kirchenoberhaupts. Die kurze Ansprache und der erste Segen „Urbi et Orbi“ (Der Stadt und dem Erdkreis), den der neue Papst dann spendet, sind die nächsten Schritte, die von Milliarden Menschen verfolgt werden. Aber der Name, der bleibt. Er wird in die Geschichtsbücher eingehen.
Wahlberechtigung und Wählbarkeit
Wahlberechtigt im Konklave sind Kardinäle, die ein bestimmtes Alter (meist unter 80 Jahren) noch nicht überschritten haben. Wählbar zum Papst ist theoretisch jeder männliche, getaufte Christ, der unverheiratet ist und ein Mindestalter (oft mit 35 Jahren angegeben) erreicht hat. In der Praxis wählen die Kardinäle jedoch fast immer einen aus ihren eigenen Reihen zum neuen Pontifex.[1] Die Namenswahl bei der Papstwahl ist dann die erste individuelle Entscheidung des Neugewählten.
Die ganze Prozedur, vom geheimen Wahlvorgang mit den Stimmzetteln, auf denen „Eligo in Summum Pontificem“ (Ich wähle zum obersten Brückenbauer) steht, bis zum weißen Rauch und der Verkündung, ist von einer jahrhundertealten Tradition geprägt.[1] Und die Namenswahl bei der Papstwahl ist ein zentraler, identitätsstiftender Teil dieses Prozesses.
Ein Name, der Geschichte schreibt
Man sieht also, die Namenswahl bei der Papstwahl ist weit mehr als nur eine Formsache. Es ist ein Akt mit enormer Tragweite, der erste Fingerzeig, wohin die Reise mit dem neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gehen könnte. Ob der neue Papst einen Namen wählt, der Kontinuität signalisiert, indem er einen Vorgänger ehrt, oder ob er mit einer überraschenden Wahl, wie Franziskus, ganz neue Akzente setzt – immer ist es eine Botschaft.
Diese Entscheidung wird oft schon im Vorfeld eines Konklave von den Kardinälen bedacht, falls sie sich selbst Chancen ausrechnen. Es ist ja nicht so, dass man erst im Moment der Wahl darüber nachdenkt. Die Bedeutung der Namen, die historischen Vorbilder, die damit verbundenen theologischen oder pastoralen Linien – all das spielt eine Rolle. Ein Papstname ist eine Verpflichtung, ein Programm, und manchmal auch eine Bürde. Er prägt die Wahrnehmung des Pontifikats von der ersten Minute an.
Die Weltöffentlichkeit, die Gläubigen, aber auch politische Beobachter horchen genau hin, wenn nach dem weißen Rauch und dem „Habemus Papam“ der gewählte Name verkündet wird. Es ist, als würde ein neues Kapitel in einem sehr alten Buch aufgeschlagen. Und der Titel dieses Kapitels, der Name des Papstes, gibt oft schon eine Ahnung von der Geschichte, die darin erzählt werden wird. Die Namenswahl bei der Papstwahl bleibt also ein spannender vielschichtiger Prozess im Herzen der katholischen Kirche. Es ist ein Moment, in dem Tradition und persönliche Entscheidung auf einzigartige Weise zusammenkommen, um den Kurs für Millionen von Menschen weltweit mitzubestimmen.
Quellen
- Konklave: Ablauf der Papst-Wahl bis zum Habemus Papam (mdr.de, abgerufen am 09. Mai 2025)
- Leo XIV.: „Ein Papst der Mitte und der Zusammenarbeit“ (tagesschau.de, abgerufen am 09. Mai 2025)
FAQs zum Thema Namenswahl bei der Papstwahl
Wie funktioniert eigentlich die Zählung bei Papstnamen, also wann wird eine römische Ziffer wie „der Zweite“ oder „der Dritte“ hinzugefügt?
Das ist eine interessante Frage, die oft für ein wenig Verwirrung sorgt! Stell dir vor, ein neu gewählter Papst entscheidet sich für einen Namen, den vor ihm noch kein anderer Papst getragen hat, so wie bei Franziskus. In diesem Fall bekommt er keine Ordnungszahl, also keine römische Ziffer wie I. oder II., angehängt; er ist dann einfach Papst Franziskus. Erst wenn ein späterer Papst denselben Namen wählt, wird dieser dann zum „Zweiten“, also zum Beispiel Franziskus II., und so weiter. Die Zählung beginnt also immer erst mit der römischen Ziffer II für den zweiten Träger dieses Namens.
Es ist auch eine ungeschriebene Regel, dass der erste Träger eines Namens die „I.“ nicht explizit führt, außer es gibt einen zweiten, wie bei Johannes Paul I., um ihn von Johannes Paul II. zu unterscheiden. Bei sehr populären Namen wie Johannes, der ja schon über zwanzig Mal gewählt wurde, sorgt die Zählung dann für eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Pontifikaten.
Gibt es außer „Petrus“ noch andere Namen, die Päpste eher meiden, und wenn ja, warum?
Du hast Recht, der Name Petrus wird aus tiefer Ehrfurcht vor dem Apostelfürsten und ersten Papst traditionell nicht erneut gewählt. Aber es gibt tatsächlich noch andere Überlegungen, die dazu führen können, dass bestimmte Namen eher selten oder gar nicht in Betracht gezogen werden. Namen von Päpsten, deren Pontifikate als besonders schwierig, umstritten oder unglücklich gelten, werden oft gemieden, um keine negativen Assoziationen oder ein schlechtes Omen heraufzubeschwören. Ebenso verhält es sich mit Namen, die eng mit Gegenpäpsten verbunden sind, da dies kirchengeschichtlich Verwirrung stiften könnte. Selbstverständlich würde auch kein Papst einen Namen wählen, der biblisch oder historisch extrem negativ besetzt ist, wie zum Beispiel Judas. Letztendlich geht es darum, einen Namen zu finden, der positiv klingt, Hoffnung vermittelt und die programmatische Ausrichtung des neuen Pontifikats unterstützt.
Was passiert eigentlich mit dem Papstnamen, wenn ein Papst von seinem Amt zurücktritt, so wie es bei Benedikt XVI. der Fall war? Behält er seinen Papstnamen?
Das ist eine sehr aktuelle und spannende Frage, da der Rücktritt eines Papstes ja historisch eine große Seltenheit darstellt und erst wenige Präzedenzfälle existieren. Im Fall von Benedikt XVI. war es so, dass er nach reiflicher Überlegung entschieden hat, seinen Papstnamen auch nach seinem Amtsverzicht weiterhin zu tragen. Er wurde dann als „Papa emeritus Benedikt XVI.“ oder „Pontifex emeritus“ angesprochen und hat damit eine neue Konvention für einen emeritierten Papst mitgeprägt. Er trug auch weiterhin die weiße, allerdings einfachere Soutane ohne das päpstliche Schultertuch, das sogenannte Pellegrina. Diese Entscheidung, den Namen und bestimmte äußere Zeichen beizubehalten, unterstreicht wohl, dass die päpstliche Identität auch nach dem Amtsverzicht eine tiefe geistliche Dimension behält, die nicht einfach abgelegt wird. Es war seine persönliche Wahl, die aber sicher auch für zukünftige, wenn auch seltene Fälle, eine gewisse Orientierung bieten könnte.