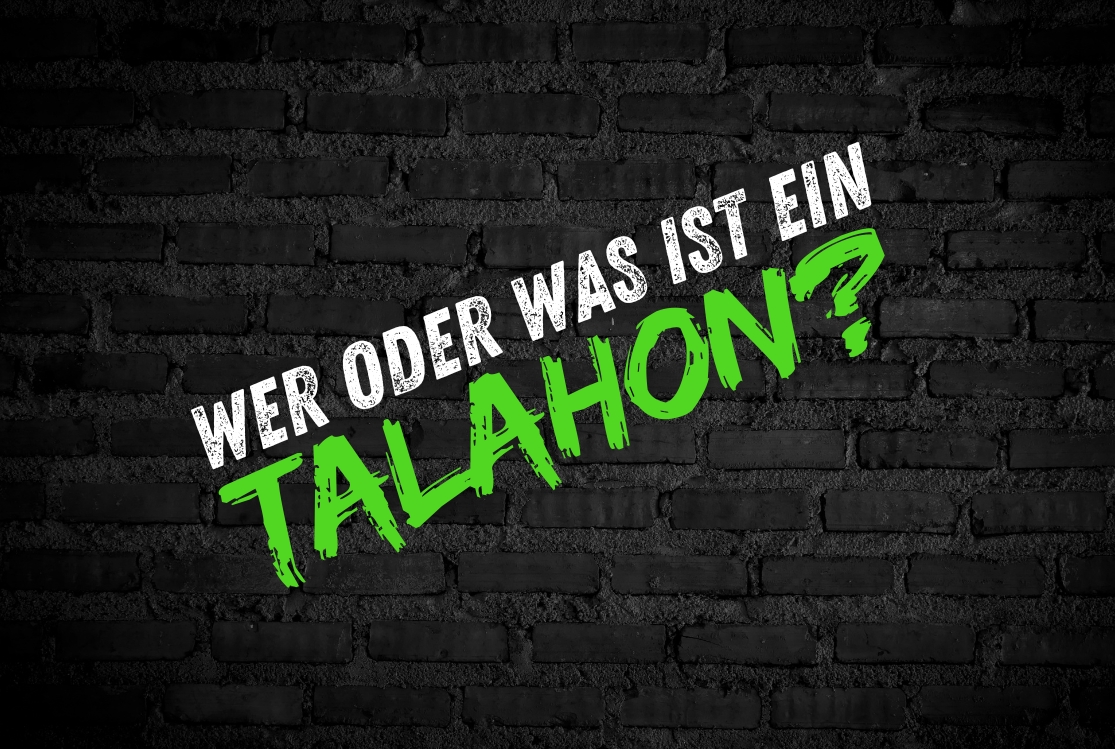„Du 31er!“ ist schnell gesagt – und meint fast nie „Paragraphenwissen“, sondern „Du hast uns verraten“. Das Wort ist so verletzend, weil es Vertrauen angreift. Gleichzeitig hat es einen echten juristischen Ursprung, der erklärt, warum der Begriff überhaupt „31“ heißt.
Was bedeutet „31er“ im Alltag?
Im Alltag ist „31er“ ein Vorwurf: Jemand hat etwas ausgeplaudert, Screenshots weitergeleitet, eine Gruppe „verpfiffen“ oder sich im Streit so verhalten, dass andere dafür geradestehen mussten. Gemeint ist meistens „Verräter“ oder „Petze“ – nur eben in Jugendsprache, oft mit maximaler Härte.[5]
Das Problem: Der Begriff wird häufig pauschal benutzt. Manchmal geht es um echten Vertrauensbruch, manchmal um Gruppendruck („Sag nichts, egal was passiert“). Und genau da kippt es schnell – weil das Wort nicht nur eine Handlung kritisiert, sondern eine Person abstempelt.
Warum heißt das ausgerechnet „31er“?
Die gängigste Erklärung (und die, die sich im Sprachgebrauch durchgesetzt hat) führt zu § 31 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG). Dort ist geregelt, dass ein Gericht unter bestimmten Voraussetzungen die Strafe mildern oder sogar ganz von Strafe absehen kann, wenn jemand freiwillig so mitwirkt, dass Straftaten aufgeklärt oder verhindert werden.[1]
Popkulturell und in der Jugendsprache wurde daraus: „§ 31“ → „31er“.[5] Auch Überblicksseiten zur Begriffsnutzung nennen genau diesen Ursprung als Kern der heutigen Bedeutung.[6]
Was steht in § 31 BtMG wirklich – und was nicht?
Wichtig ist die Trennung zwischen Gesetz und Schulhoflogik.
Im Gesetz steht nicht „Verräter“. § 31 BtMG ist ein Instrument der Strafverfolgung: Es soll Aufklärung erleichtern, indem es einen Anreiz schafft, Informationen beizutragen, die Ermittlungen voranbringen oder neue Taten verhindern.[1] Ob und wie stark das wirkt, ist juristisch seit Jahrzehnten ein Diskussionsthema – unter anderem, weil solche Regelungen immer auch Missbrauchsrisiken und Gerechtigkeitsfragen mitbringen.[4]
Drei Punkte helfen, § 31 BtMG realistisch einzuordnen:
- „Kann“ statt „muss“: Das Gericht darf mildern, es ist nicht verpflichtet.[1]
- Es geht um relevante Aufklärungshilfe: Nicht jedes „Erzählen“ reicht. Juristische Darstellungen arbeiten genau heraus, welche Qualität die Hilfe haben muss und wie Gerichte das prüfen.[4]
- Das Prinzip existiert auch außerhalb des BtMG: Im Strafgesetzbuch gibt es mit § 46b StGB eine Regelung zur Aufklärungshilfe bei schweren Straftaten, die ähnlich funktioniert, aber anders zugeschnitten ist.[2]
Übersetzt: Der „31er“-Vorwurf ist eine moralische Deutung (Loyalität/Illoyalität). Das Gesetz ist eine rechtliche Konstruktion (Aufklärung/Prävention). Das ist nicht dasselbe.
Warum der Vorwurf so eskaliert
Der Begriff trifft so stark, weil er an eine Grundregel vieler Gruppen rührt: „Intern bleibt intern.“ Wird das gebrochen, entsteht schnell ein Gefühl von Kontrollverlust. Dann wird nicht mehr sachlich geklärt, was passiert ist, sondern es wird sortiert: Wer gehört dazu, wer nicht?
Typisch ist dabei ein Muster, das man in Cliquen, Teams, Chatgruppen und Klassen immer wieder sieht:
- Ein Konflikt entsteht und alle suchen nach einer eindeutigen Ursache.
- Ein Name wird als Schuldiger markiert, damit die Gruppe wieder „stabil“ wirkt.
- Die eigentliche Frage („Was ist passiert und warum?“) wird durch ein Etikett ersetzt.
Das erklärt, warum „31er“ oft nicht nur Streit ist, sondern Ausgrenzung nach sich ziehen kann – besonders online, wo Screenshots, Reposts und Kommentare den Druck verstärken.
„31er“ im Netz: Verrat, Bloßstellung und der Klickmoment
Im digitalen Alltag hat „31er“ eine zweite, sehr konkrete Spielart bekommen: Inhalte weiterleiten, obwohl klar ist, dass sie privat waren. Ein Screenshot aus einem Chat, ein geleaktes Foto, eine Sprachnachricht in der falschen Gruppe – das wird schnell als „31er-Aktion“ bezeichnet, weil es sich wie „ans Messer liefern“ anfühlt.
Hier lohnt ein nüchterner Gedanke: Online ist der Schaden oft größer als die ursprüngliche Sache. Denn was einmal geteilt wurde, bleibt nicht im Raum hängen wie ein Satz auf dem Schulhof – es kann sich vervielfältigen.
Wann ist „Petzen“ nicht „31er“?
Es gibt Situationen, in denen Schweigen nicht „loyal“, sondern gefährlich ist. Wenn Gewalt droht, wenn jemand erpresst wird, wenn es um Missbrauch, schwere Bedrohung oder akute Selbstgefährdung geht, ist Hilfe holen kein Verrat, sondern Verantwortung.
Ein brauchbarer Prüfstein ist diese Frage: Geht es um Schutz und Sicherheit – oder um Vorteil und Selbstrettung auf Kosten anderer?
Das ist nicht immer bequem, aber es verhindert, dass ein Jugendwort Menschen davon abhält, in ernsten Situationen Unterstützung zu bekommen.
Was tun, wenn du als „31er“ bezeichnet wirst?
Wenn dir der Vorwurf entgegenfliegt, hilft Gegenangriff selten. Was eher funktioniert, ist Klarheit – ohne Show.
- Frag konkret nach dem Vorwurf. „Was genau habe ich deiner Meinung nach weitergegeben?“
- Trenn Gefühl und Fakt. „Ich sehe, dass dich das trifft. Ich will trotzdem klären, was stimmt.“
- Wenn du einen Fehler gemacht hast, benenn ihn klar und ohne Ausreden. Eine Entschuldigung wirkt nur, wenn sie nicht verwässert.
- Wenn es eskaliert, beende das Gespräch sauber. „So reden wir gerade nicht sinnvoll weiter. Später gern, ruhiger.“
Wenn das Ganze online passiert: Screenshots sichern, Zeitstempel behalten, nicht impulsiv zurückschießen. Je nachdem, wie das läuft, kann es sinnvoll sein, eine Vertrauensperson einzubeziehen (Schulsozialarbeit, Lehrkraft, Eltern). Das ist nicht „schwach“, sondern schützt dich, bevor sich etwas verselbstständigt.
Was bleibt unterm Strich?
„31er“ ist ein Wort, das Loyalität erzwingen kann – und manchmal echte Enttäuschung ausdrückt. Der Ursprung über § 31 BtMG erklärt, warum der Begriff so negativ aufgeladen ist: Er steht im Kern für „Aussagen, die anderen schaden, um selbst besser wegzukommen“.[1] Gleichzeitig wird er im Alltag oft zu pauschal benutzt – und dann trifft er Menschen, die gerade einfach nur versucht haben, eine schwierige Lage sicher zu lösen.
Quellen
- Bundesministerium der Justiz (Gesetze im Internet): § 31 BtMG – Strafmilderung oder Absehen von Strafe, abgerufen am 06.01.2026.
- Bundesministerium der Justiz (Gesetze im Internet): § 46b StGB – Hilfe zur Aufklärung oder Verhinderung von schweren Straftaten, abgerufen am 06.01.2026.
- Bundesgerichtshof: Wortprotokoll (Gesetzesmaterialien u. a. zu § 31 BtMG / § 46b StGB), abgerufen am 06.01.2026.
- Jurawelt (PDF): Der Aufklärungsgehilfe nach § 31 BtMG, abgerufen am 06.01.2026.
- GIGA: „31er – Bedeutung des Hip-Hop-Slangwortes“, abgerufen am 06.01.2026.
- Wikipedia: „31er“ (Überblick zu Herkunft und Bedeutungswandel), abgerufen am 06.01.2026.
FAQs zum Thema Was ist ein 31er?
Ist „31er“ immer ein Begriff aus dem Strafrecht?
Nein. Der Ausdruck wird zwar häufig mit § 31 BtMG erklärt, wird heute aber in der Jugendsprache vor allem als „Verräter“/„Petze“ genutzt – oft ohne jeden Bezug zu echten Verfahren.[5]
Warum hat das Wort so einen „finalen“ Beigeschmack?
Weil es nicht nur ein Verhalten kritisiert, sondern die Zugehörigkeit infrage stellt. Wer als „31er“ gilt, wird schnell als „nicht vertrauenswürdig“ einsortiert – und das kann in Gruppen Ausgrenzung auslösen.
Was ist, wenn ich etwas melde, weil jemand in Gefahr ist?
Wenn es um Sicherheit geht (Gewalt, Erpressung, Missbrauch, akute Bedrohung), ist Hilfe holen kein „Verrat“, sondern Verantwortung. Das Wort „31er“ wird in solchen Situationen manchmal als Druckmittel benutzt, damit jemand schweigt – und genau das ist riskant.