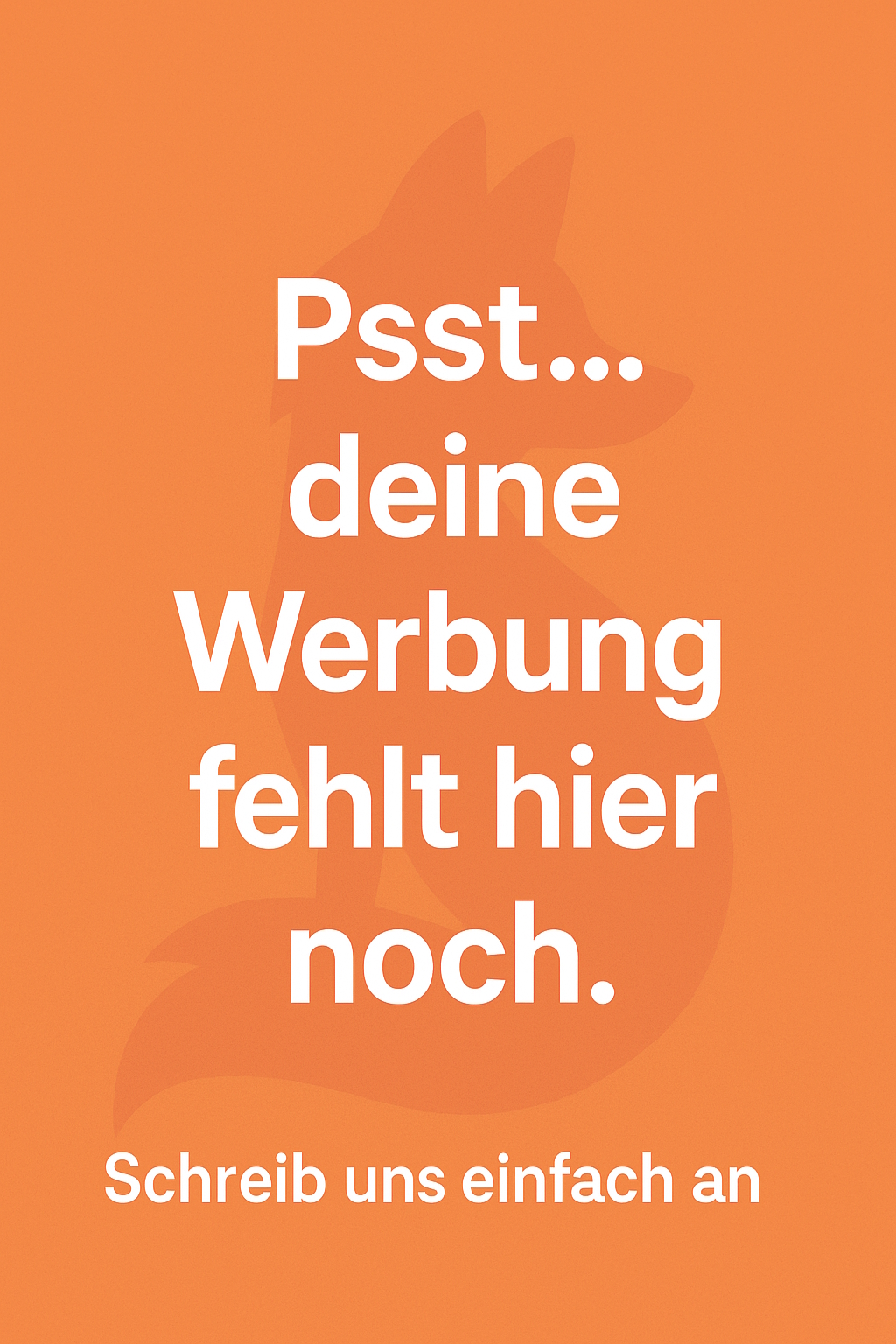Jedes Mal, wenn ich an einer dieser ordentlich aufgereihten kleinen Parzellen vorbeifahre, frage ich mich, was sich hinter den Hecken verbirgt. Da sind die perfekten Rasenflächen, die wuchernden Zucchini-Pflanzen und die kleinen Lauben, aus denen am Wochenende Grillrauch aufsteigt. Die Frage, wieso es Schrebergarten heißt, ist dabei mehr als nur eine historische Neugier – sie erzählt eine überraschende Geschichte über Stadtentwicklung, soziale Ideen und ein ziemlich großes Missverständnis.
Ein Name, der in die Irre führt
Die Idylle eines Kleingartens, die wir heute kennen, hat mit dem Mann, der ihr den Namen gab, erstaunlich wenig zu tun. Dr. Moritz Schreber, ein Leipziger Arzt und Hochschullehrer aus dem 19. Jahrhundert, war kein Gärtner. Er hat weder den ersten Spatenstich gemacht noch je eine eigene Parzelle besessen. Seine Leidenschaft galt einem ganz anderen Thema: der Volksgesundheit und der Pädagogik. Er war überzeugt, dass die Industrialisierung und das Stadtleben Kinder und Erwachsene krank machten. Seine Vision war, durch Gymnastik, frische Luft und eine strenge, körperbewusste Erziehung eine gesündere Gesellschaft zu formen.
Seine Methoden waren, aus heutiger Sicht, ziemlich radikal. Er entwickelte orthopädische Geräte, die eine „gerade Haltung“ erzwingen sollten und schrieb Bücher über die richtige Kindererziehung, die von Disziplin und Kontrolle geprägt waren. Mit dem entspannten Gärtnern am Wochenende hatte das alles nichts zu tun. Die Idee für die Gärten kam von jemand anderem, und zwar erst nach Schrebers Tod. Der Name blieb trotzdem an ihm haften – eine Ironie der Geschichte.
Die wahre Geburt der Kleingärten: Eine Idee für Kinder
Der eigentliche Initiator war ein Leipziger Schuldirektor namens Ernst Innocenz Hauschild. Er war ein Anhänger von Schrebers Ideen zur Förderung der Kindergesundheit und gründete 1864, wenige Jahre nach Schrebers Tod, den ersten „Schreberverein“. Dessen Ziel war es, Spielplätze zu schaffen, auf denen sich Stadtkinder an der frischen Luft austoben konnten. Der erste dieser Plätze wurde zu Ehren des verstorbenen Arztes „Schreberplatz“ genannt.
Ein Lehrer an dieser Schule, Heinrich Karl Gesell, hatte dann den entscheidenden Einfall. Er schlug vor, am Rande dieses Spielplatzes kleine Beete anzulegen. Hier sollten die Kinder unter Aufsicht selbst gärtnern können. Diese „Kinderbeete“ waren der eigentliche Vorläufer des heutigen Schrebergartens. Die Idee war also ursprünglich ein rein pädagogisches Projekt. Doch es kam anders. Die Kinder verloren schnell das Interesse, aber ihre Eltern übernahmen die Pflege der kleinen Parzellen mit wachsender Begeisterung. Aus den Kinderbeeten wurden Familiengärten, die bald so populär waren, dass ganze „Schreberkolonien“ entstanden.
Moritz Schrebers seltsame Erziehungsideen
Dr. Schreber war nicht nur ein Gesundheitsfanatiker, sondern auch Erfinder bizarrer Apparate. Dazu gehörte der „Geradhalter“, ein Riemen, der Kinder zwang, aufrecht zu sitzen, indem er die Haare nach oben zog, sobald sie krumm saßen. Auch ein Kinnband, das nächtliches Kieferöffnen verhindern sollte, gehörte zu seinem Repertoire. Seine Vision von Gesundheit war stark von Zwang und mechanischer Disziplin geprägt.
Wieso heißt es Schrebergarten, wenn die Idee von anderen kam?
Der Name ist also ein Denkmal, das eigentlich dem Falschen gesetzt wurde. Hauschild wollte mit dem Namen „Schreberplatz“ die Bewegung ehren, die Schreber für die Volksgesundheit ins Leben gerufen hatte. Es war eine Geste des Respekts für seine übergeordneten Ziele. Als aus den Spielplätzen Gärten wurden, übernahm man den etablierten Namen einfach, ohne groß darüber nachzudenken. Der Name „Schrebergarten“ verbreitete sich schnell in ganz Deutschland, während die Namen der wahren Väter, Hauschild und Gesell, weitgehend in Vergessenheit gerieten.
Es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie eine Marke oder ein Name ein Eigenleben entwickeln kann. Schreber lieferte die ideologische Grundlage – die Sehnsucht nach Natur und Gesundheit als Ausgleich zum Stadtleben. Hauschild und Gesell lieferten die praktische Umsetzung. Der Name aber blieb beim Vordenker, nicht bei den Machern. Und so verbinden wir heute mit dem Begriff Schrebergarten nicht mehr strenge Erziehung, sondern das genaue Gegenteil: Freizeit, Selbstverwirklichung und ein kleines Stück private Freiheit.
Der Schrebergarten heute: Zwischen Vereinsmeierei und moderner Oase
Was aus dieser pädagogischen Idee geworden ist, hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Die heutigen Kleingartenanlagen sind durch das Bundeskleingartengesetz streng geregelt. Dieses Gesetz legt genau fest, wie groß eine Laube sein darf (maximal 24 Quadratmeter Grundfläche) und dass mindestens ein Drittel der Fläche dem Anbau von Obst und Gemüse dienen muss. Das soll den Erholungscharakter sichern und eine rein kommerzielle Nutzung verhindern.
Ich finde diesen Spagat interessant. Einerseits ist da der Wunsch nach individueller Freiheit, dem eigenen kleinen Reich. Andererseits gibt es die Vereinsstruktur mit ihren Regeln zu Heckenhöhe, Ruhezeiten und Gemeinschaftsarbeit. Das kann manchmal zu Konflikten führen, sorgt aber auch für den Erhalt dieser grünen Lungen in den Städten. Gerade in den letzten Jahren erlebe ich, wie sich die Gärten wieder verändern. Jüngere Familien und Paare entdecken die Parzellen für sich, bauen Hochbeete, installieren Solarpanele auf dem Laubendach und experimentieren mit Permakultur. Hier eine kleine Gegenüberstellung, wie sich die Idee gewandelt hat:
| Merkmal | Ursprüngliche Idee (um 1865) | Moderner Schrebergarten (heute) |
|---|---|---|
| Hauptzweck | Spiel- und Lernort für Schulkinder | Erholung und nicht-gewerblicher Anbau |
| Nutzergruppe | Kinder unter pädagogischer Aufsicht | Erwachsene, Familien, Paare als Pächter |
| Bebauung | Keine, höchstens ein Geräteschuppen | Laube mit bis zu 24 m² Grundfläche erlaubt |
| Regulierung | Durch den lokalen Verein oder die Schule | Bundeskleingartengesetz und Vereinssatzung |
| Anbau | Pädagogisches Gärtnern mit Blumen und Gemüse | Mindestens ein Drittel der Fläche für Obst/Gemüse |
[BESTSELLER „Gartengeräte Set“]
Ein Stück Grün mit Geschichte
Letztlich ist der Name „Schrebergarten“ eine historische Kuriosität, die eine viel tiefere Geschichte über die sozialen Bedürfnisse der Menschen erzählt. Er steht für den Wunsch, der Enge der Städte zu entfliehen und etwas mit den eigenen Händen zu schaffen. Ob damals aus gesundheitlichen und pädagogischen Gründen oder heute als Ausgleich zum digitalen Alltag – die Grundidee ist die gleiche geblieben. Und wenn ich das nächste Mal an einer Kleingartenanlage vorbeikomme, sehe ich nicht nur gepflegte Beete, sondern auch das Erbe eines strengen Arztes, eines engagierten Schuldirektors und eines kreativen Lehrers. Eine ziemlich gute Geschichte für ein kleines Stück Land.
FAQs zum Thema Wieso heißt es Schrebergarten
Gibt es so etwas wie Schrebergärten auch in anderen Ländern?
Ja, auf jeden Fall! Die Idee des Kleingartens ist international sehr verbreitet, auch wenn die Namen sich unterscheiden. In Großbritannien nennt man sie zum Beispiel „allotment gardens“, in Frankreich „jardins familiaux“ (Familiengärten) und in Polen „ogródki działkowe“. Das Grundprinzip – eine kleine, gepachtete Parzelle zur Erholung und für den Anbau – ist dabei weltweit sehr ähnlich und beliebt.
Waren die Gärten von Anfang an nur zur Erholung gedacht?
Nein, ganz und gar nicht. Obwohl die erste Anlage in Leipzig als pädagogisches Projekt startete, wurde die Selbstversorgung schnell zu einem wichtigen Aspekt. Besonders in Krisenzeiten, wie während der beiden Weltkriege, waren die Kleingärten für viele Stadtfamilien überlebenswichtig. Sie sicherten die Ernährung und wurden von der Regierung sogar gezielt gefördert, um Hungersnöte zu lindern.
Was passiert eigentlich, wenn man sich nicht an die Regeln des Kleingartenvereins hält?
Wenn du gegen die Regeln der Vereinssatzung verstößt, zum Beispiel durch eine zu hohe Hecke oder ständige Lärmbelästigung, folgt meist ein klares Verfahren. Zuerst erhältst du eine mündliche oder schriftliche Abmahnung vom Vereinsvorstand. Ignorierst du diese, können Geldstrafen oder die Pflicht zur Beseitigung des Problems folgen. Im schlimmsten Fall, bei wiederholten oder schweren Verstößen, kann dir der Verein den Pachtvertrag kündigen.