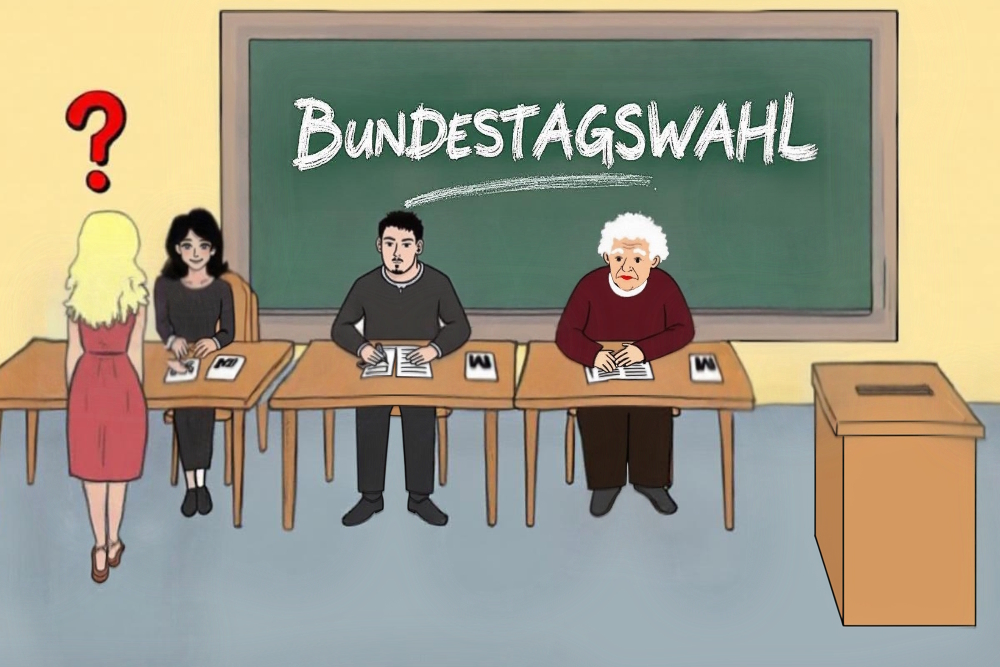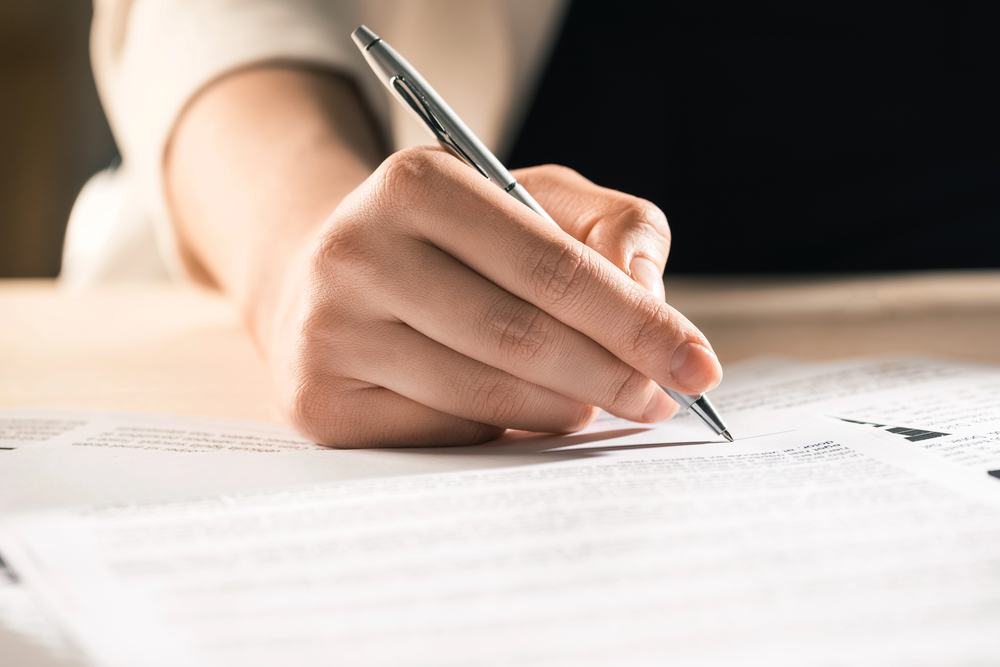Kurzfassung
- Polizeieinsatz bei Ruhestörung wird grundsätzlich aus Steuergeldern finanziert, nicht vom Verursacher getragen.
- Bußgelder für Lärmbelästigung treffen den Störer finanziell und variieren je nach Schwere und Häufigkeit des Verstoßes.
- Vorsätzliche oder wiederholte Verstöße können Gebührenbescheid für den Polizeieinsatz nach sich ziehen.
- Recht auf Ruhe steht im Ordnungswidrigkeitengesetz, kontra Lärmbelästigung durch Nachbarn ab 22 Uhr.
- Kommunikation mit Nachbarn kann viele Polizeieinsätze und potenzielle Bußgelder vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
- Der Klassiker: Die Party nebenan eskaliert – und nun?
- Was Lärm eigentlich zur Ruhestörung macht
- Die feine Linie: Wann wird aus Geräusch eine Belästigung?
- Gesetzliche Grundlagen: Ein Blick ins Kleingedruckte
- Der Anruf bei der 110: Wann rückt die Polizei an?
- Ruhestörung melden: Die Polizei als letzter Ausweg
- Was passiert, wenn die Polizei klingelt?
- Die Kostenfrage: Wer zahlt den Polizeieinsatz bei Ruhestörung wirklich?
- Der Grundsatz: Öffentliche Aufgabe, öffentliche Kasse
- Ausnahmen bestätigen die Regel: Wann der Störer blechen muss
- Bußgeld wegen Lärmbelästigung: Mehr als nur ein Denkzettel?
- Vermeiden statt zahlen: So bleibt die Polizei (und die Rechnung) fern
- Kommunikation ist wirklich wichtig: Das Gespräch mit den Nachbarn
- Hausordnung und Co.: Die Spielregeln des Zusammenlebens
- Spezialfälle der Ruhestörung: Von Kinderlärm bis zum nächtlichen Bohren
- Kinder, Tiere, Instrumente: Was ist noch zumutbar?
- Die Frage der Verhältnismäßigkeit bei einem Polizeieinsatz
- Mythos: Einmal im Jahr Party ist erlaubt?
- Konsequenzen und was du daraus lernen kannst
- Fazit: Wer am Ende für den Polizeieinsatz bei Ruhestörung aufkommt
- FAQs zum Thema Wer zahlt Polizeieinsatz bei Ruhestörung
- Kann ich eine Ruhestörung auch anonym der Polizei melden?
- Welche Rolle spielt mein Vermieter, wenn ich ihm eine Ruhestörung durch andere Mieter melde?
- Muss ich als Anrufer für den Polizeieinsatz zahlen, wenn sich herausstellt, dass vor Ort gar keine Ruhestörung (mehr) vorlag?
- Was ist, wenn die Ruhestörung nicht von einem direkten Nachbarn, sondern zum Beispiel von einer Gruppe im Park oder auf der Straße ausgeht?
Samstagabend, die Bässe wummern von nebenan, an Schlaf ist nicht zu denken. Wenn Reden nicht mehr hilft und die Polizei anrückt, stellt sich schnell die Frage: Wer zahlt eigentlich den Polizeieinsatz bei einer Ruhestörung?
Der Klassiker: Die Party nebenan eskaliert – und nun?
Stell dir vor, es ist weit nach Mitternacht. Du liegst im Bett, versuchst zu schlafen, aber aus der Nachbarwohnung dröhnt Musik, als wäre morgen Weltuntergang. Gläser klirren, lautes Gelächter, Gesang – die volle Packung. Du hast schon geklingelt, freundlich gebeten, die Musik leiser zu drehen. Vielleicht hast du es auch weniger freundlich versucht. Gebracht hat es nichts. Irgendwann reißt dir der Geduldsfaden, und du wählst die 110. Die Polizei kommt, sorgt für Ruhe. Aber was bleibt, ist oft nicht nur der verärgerte Nachbar, sondern auch die Unsicherheit: Wer kommt für die Kosten dieses Einsatzes auf? Die Frage, wer zahlt den Polizeieinsatz bei Ruhestörung, ist tatsächlich nicht immer pauschal zu beantworten.
Es ist ein schmaler Grat zwischen dem Recht auf die eigene Entfaltung und dem Ruhebedürfnis der Nachbarn. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner alten WG. Wir hatten eine kleine Feier, dachten, wir wären rücksichtsvoll. Waren wir aber offenbar nicht genug. Die Polizei stand vor der Tür, freundlich, aber bestimmt. Da fragt man sich schon, was da noch nachkommt.
Was Lärm eigentlich zur Ruhestörung macht
Lärm ist ja erstmal subjektiv. Was den einen stört, nimmt der andere vielleicht gar nicht wahr. Aber es gibt Grenzen, und die sind auch irgendwo definiert, damit das Zusammenleben funktioniert. Eine Ruhestörung liegt vor, wenn Lärm ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidbaren Ausmaß erregt wird, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. So steht es sinngemäß im Ordnungswidrigkeitengesetz (§ 117 OWiG). [2]
Die feine Linie: Wann wird aus Geräusch eine Belästigung?
Es geht also nicht um jedes Geräusch. Das Tapsen der Kinder in der Wohnung über dir ist meistens hinzunehmen, auch wenn es mal nervt. Aber die Stereoanlage, die nachts um drei auf Konzertlautstärke läuft, ist eine andere Hausnummer. Die Zimmerlautstärke ist hier ein wichtiger Begriff. Die Rechtsprechung sagt, dass Geräusche außerhalb der Wohnung, in der sie entstehen, nicht mehr oder kaum noch wahrnehmbar sein dürfen, besonders während der Ruhezeiten. [3] Tagsüber gelten oft um die 40 Dezibel als Richtwert, nachts um die 30 Dezibel. [3] Das ist leiser als ein normales Gespräch.
Die typischen Ruhezeiten sind meist zwischen 22 Uhr und 6 Uhr (Nachtruhe) und oft auch eine Mittagsruhe von 13 bis 15 Uhr. An Sonn- und Feiertagen gilt ganztägig eine erweiterte Ruhepflicht. [2] Aber Achtung: Das kann regional und sogar von Hausordnung zu Hausordnung variieren. Ein Blick in den eigenen Mietvertrag oder die Hausordnung ist da oft erhellend. Wer sich unsicher ist, welche Ruhezeiten gelten, kann sich auch beim Ordnungsamt erkundigen. [3] Die Frage, wer den Polizeieinsatz bei Ruhestörung zahlt, hängt oft auch davon ab, wie eklatant gegen diese Regeln verstoßen wurde.
Gesetzliche Grundlagen: Ein Blick ins Kleingedruckte
Ein spezielles „Ruhestörungsgesetz“ gibt es in Deutschland nicht. Vielmehr setzen sich die Regeln aus verschiedenen Gesetzen und Verordnungen zusammen. Neben dem schon genannten § 117 OWiG spielen das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und die Landes-Immissionsschutzgesetze der Bundesländer eine Rolle. Für bestimmte Lärmquellen, wie Rasenmäher oder Laubbläser, gibt es sogar eigene Verordnungen, die festlegen, wann diese Geräte betrieben werden dürfen (z.B. die 32. BImSchV). [3] Auch Kommunen können eigene Satzungen erlassen. Es ist also ein ziemlicher Flickenteppich, aber im Kern geht es immer um Rücksichtnahme. Wenn man es ganz genau nimmt, ist das Thema Ruhestörung melden also rechtlich gut untermauert, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt.
Der Anruf bei der 110: Wann rückt die Polizei an?
Die Polizei kommt nicht wegen jeder Kleinigkeit. Aber wenn die Nerven blank liegen und die Ruhestörung unerträglich wird, ist sie oft der letzte Anker. Die Beamten versuchen dann meist, die Situation vor Ort zu klären. Das beginnt mit einer Ermahnung. Die Polizei dokumentiert den Vorfall und versucht, die Verursacher zur Einsicht zu bewegen. Sie können auch die Lautstärke messen.
Wenn Ermahnungen nichts fruchten, kann es härter zur Sache gehen. Die Polizei kann Partygäste nach Hause schicken oder im Extremfall sogar die Musikanlage sicherstellen. [2] Ob und wie schnell die Polizei einschreitet, hängt von der Einschätzung der Lage vor Ort ab. Die Frage, wer den Polizeieinsatz bei einer Ruhestörung zahlt, wird dann relevanter, wenn es nicht bei einer einmaligen Ermahnung bleibt.
Ruhestörung melden: Die Polizei als letzter Ausweg
Bevor du zum Hörer greifst, um eine Lärmbelästigung melden zu wollen, ist es meistens ratsam, erst das Gespräch mit dem Verursacher zu suchen. Die Gewerkschaft der Polizei empfiehlt das auch. [3] Ein direkter, aber ruhiger Hinweis kann oft Wunder wirken. Viele sind sich gar nicht bewusst, wie laut sie sind oder dass sie stören. Eskaliert die Situation aber oder ist der Störer uneinsichtig, ist der Anruf bei der Polizei legitim. Es geht ja um dein Recht auf Ruhe in den eigenen vier Wänden. Die Polizei ist dann da, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
Was passiert, wenn die Polizei klingelt?
Die Beamten dürfen wegen einer reinen Ruhestörung nicht einfach so deine Wohnung betreten. Sie müssen zunächst an der Tür das Gespräch mit dir als Veranstalter oder Verursacher suchen. Nur wenn ein begründeter Verdacht auf eine Straftat besteht (z.B. Drogenkonsum auf einer Party), dürfen sie sich unter Umständen auch ohne deine Zustimmung Zutritt verschaffen.[2] Ansonsten gilt: Verhältnismäßigkeit wahren.
Die Kostenfrage: Wer zahlt den Polizeieinsatz bei Ruhestörung wirklich?
Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Die landläufige Meinung ist oft: Der Verursacher zahlt. Aber so einfach ist es meistens nicht. Grundsätzlich ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Kernaufgabe des Staates, die aus Steuergeldern finanziert wird. [1] Das bedeutet, dass der „normale“ Polizeieinsatz wegen Ruhestörung in der Regel nicht direkt dem Verursacher in Rechnung gestellt wird. Du zahlst also nicht dafür, dass die Polizei kommt und deinen Nachbarn zur Ruhe ermahnt.
Der Grundsatz: Öffentliche Aufgabe, öffentliche Kasse
Die Polizei wird für alle Bürger tätig, ohne dass dafür direkt Gebühren erhoben werden – dafür zahlen wir ja Steuern. Stell dir vor, du müsstest jedes Mal zahlen, wenn du die Polizei rufst, etwa bei einem Verkehrsunfall ohne dein Verschulden. Das wäre ja absurd. Und ähnlich verhält es sich zunächst auch bei der Ruhestörung. Die Polizei sorgt für Ordnung, und das ist eine staatliche Leistung. Meistens lässt sich die Frage, wer den Polizeieinsatz bei Ruhestörung zahlt, also mit: die Allgemeinheit beantworten.
Aber es gibt natürlich, wie so oft im Leben, Ausnahmen von dieser Regel. Und die können dann durchaus ins Geld gehen.
Ausnahmen bestätigen die Regel: Wann der Störer blechen muss
Es gibt Situationen, in denen der Verursacher doch zur Kasse gebeten werden kann. Das betrifft vor allem Fälle, in denen jemand vorsätzlich und wiederholt gegen Auflagen verstößt oder die Polizei quasi mutwillig beschäftigt. Wenn beispielsweise eine Party trotz mehrfacher polizeilicher Aufforderung immer wieder laut wird oder jemand bewusst Falschmeldungen absetzt.
Ein Bereich, der auch immer wieder diskutiert wird, sind Polizeieinsätze bei kommerziellen Großveranstaltungen, wie Fußballspielen oder großen Konzerten. Hier fordert beispielsweise die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), dass die Veranstalter an den Kosten beteiligt werden, da diese Events auf Gewinn ausgerichtet sind. [1] Das ist zwar nicht direkt auf die private Ruhestörung übertragbar, zeigt aber, dass die Diskussion um die Kostentragung von Polizeieinsätzen geführt wird. Manchmal kann es auch sein, dass bei sehr hartnäckigen oder gewerbsmäßigen Ruhestörern (z.B. eine ständig laute Kneipe ohne Lärmschutzmaßnahmen) Gebührenbescheide erlassen werden. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel bei der typischen Nachbarschafts-Ruhestörung.
Bußgeld wegen Lärmbelästigung: Mehr als nur ein Denkzettel?
Was allerdings fast immer droht, wenn die Ruhestörung erheblich war und vielleicht sogar wiederholt auftrat, ist ein Bußgeld wegen Lärmbelästigung. Das ist keine Bezahlung für den Einsatz an sich, sondern eine Strafe für die Ordnungswidrigkeit. Diese Bußgelder können je nach Schwere und Häufigkeit des Verstoßes variieren. Für eine nächtliche Ruhestörung muss man mit einem Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich rechnen, aber das Ordnungswidrigkeitengesetz sieht einen Rahmen von bis zu 5.000 Euro vor. [2] Dieses Geld fließt dann in die Staatskasse, nicht direkt zur Deckung der Einsatzkosten. Aber es ist natürlich eine finanzielle Konsequenz für den Störer.
Die folgende Tabelle gibt einen groben Überblick, wer in welchen Fällen typischerweise zahlt, aber das ist immer eine Einzelfallbetrachtung:
| Situation | Wer trägt typischerweise die direkten Einsatzkosten? | Mögliche weitere finanzielle Folgen für den Störer |
|---|---|---|
| Einmalige Ruhestörung, Polizei ermahnt | Allgemeinheit (Steuerzahler) | Evtl. Verwarnung, selten direkt Bußgeld |
| Wiederholte Ruhestörung trotz Ermahnung | Allgemeinheit (Steuerzahler) | Bußgeld sehr wahrscheinlich |
| Mutwillige, vorsätzliche Störung / Falschalarm | Verursacher (kann in Rechnung gestellt werden) | Bußgeld, ggf. strafrechtliche Folgen |
| Polizeieinsatz bei kommerzieller Großveranstaltung (z.B. Fußballspiel ohne Ausschreitungen) | Allgemeinheit (laufende Debatte um Kostenbeteiligung Veranstalter) [1] | – |
| Polizeieinsatz wegen verbotener Demonstration | Teilnehmer können ggf. herangezogen werden [1] | Bußgelder, Strafverfahren |
Es ist also nicht so, dass die Frage, wer zahlt Polizeieinsatz bei Ruhestörung, immer mit „der Störer“ beantwortet wird. Die direkten Einsatzkosten trägt oft die Allgemeinheit, das Bußgeld wegen Lärmbelästigung ist dann die eigentliche „Strafe“ für den Verursacher.
Vermeiden statt zahlen: So bleibt die Polizei (und die Rechnung) fern
Am besten ist es natürlich, wenn es gar nicht erst so weit kommt, dass die Polizei anrücken muss. Das spart Nerven, Ärger und potenziell auch Geld, wenn man mal an das Bußgeld denkt. Ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft ist da Gold wert.
Kommunikation ist wirklich wichtig: Das Gespräch mit den Nachbarn
Ich kann es nicht oft genug sagen: Redet miteinander! Wenn du eine Feier planst, informiere deine Nachbarn vorher. Ein kleiner Zettel im Hausflur oder ein kurzes persönliches Gespräch kann schon viel bewirken. [2] Bitte um Verständnis und gib vielleicht sogar eine Telefonnummer an, unter der du erreichbar bist, falls es doch mal zu laut wird. Oft sind die Leute viel toleranter, wenn sie vorher Bescheid wissen. Und umgekehrt: Wenn dich Lärm stört, suche erst das Gespräch, bevor du dazu übergehst, eine Ruhestörung zu melden. Manchmal ist es dem Verursacher gar nicht bewusst.
Hausordnung und Co.: Die Spielregeln des Zusammenlebens
Jedes Mietshaus hat in der Regel eine Hausordnung. Darin sind oft auch die Ruhezeiten und andere Verhaltensregeln festgelegt. Diese Hausordnung ist Teil des Mietvertrages und damit für alle Bewohner verbindlich. Sich daran zu halten, ist schon die halbe Miete für ein friedliches Zusammenleben. Und ja, das bedeutet auch, dass man nach 22 Uhr die Musik auf Zimmerlautstärke dreht und nicht unbedingt mit dem Schlagzeugsolo beginnt. Auch hier ist die Frage nach, wer den Polizeieinsatz bei Ruhestörung zahlt, oft schon im Keim erstickt, wenn sich alle an die Regeln halten.
Spezialfälle der Ruhestörung: Von Kinderlärm bis zum nächtlichen Bohren
Es gibt natürlich Lärmquellen, die immer wieder für Diskussionen sorgen. Nicht jeder Lärm ist gleich eine Ruhestörung, für die man die Polizei rufen sollte oder die gar zu Kosten führt.
Kinder, Tiere, Instrumente: Was ist noch zumutbar?
Kinderlärm ist so ein Thema. Grundsätzlich gilt Kinderlärm nicht als schädliche Umwelteinwirkung und ist in höherem Maße hinzunehmen. [2], [3] Das gilt auch für Babygeschrei in der Nacht. Klar, es kann nerven, aber Kinder sind nun mal Kinder. Auch das Musizieren in der Wohnung ist erlaubt, allerdings nicht unbegrenzt. Die Gerichte haben hier unterschiedliche Zeiten zugestanden, meist ein bis zwei Stunden täglich außerhalb der Ruhezeiten, je nach Instrument. [3] Beim Schlagzeug ist die Toleranzgrenze naturgemäß niedriger als beim Klavier. Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Staubsauger dürfen auch während der Ruhezeiten betrieben werden, wenn es unaufschiebbar ist, aber auch hier gilt das Gebot der Rücksichtnahme. [3] Nächtliches Duschen ist ebenfalls erlaubt, aber ausufernde Badeorgien sollte man vermeiden. [2]
Folgende Geräusche sind oft Streitthemen, aber nicht immer gleich Grund für einen Polizeieinsatz:
- Normaler Kinderlärm und Spielen zu üblichen Zeiten.
- Das Bellen eines Hundes, solange es nicht überhandnimmt und dauerhaft stört.
- Übliche Haushaltsgeräusche wie Staubsaugen oder Waschmaschine laufen lassen außerhalb der tiefsten Nachtruhe.
- Das Spielen eines Musikinstruments für eine begrenzte Dauer pro Tag (außerhalb der Ruhezeiten).
- Kurzes Duschen oder Baden auch nach 22 Uhr.
- Gespräche in normaler Lautstärke auf dem Balkon oder im Garten.
Die Frage der Verhältnismäßigkeit bei einem Polizeieinsatz
Auch die Polizei muss immer die Verhältnismäßigkeit wahren. Wegen einer einmalig etwas zu lauten Unterhaltung wird sie nicht gleich die Tür eintreten. Es geht darum, erhebliche Belästigungen abzustellen. Die Entscheidung, wie gravierend eine Ruhestörung ist und welche Maßnahmen getroffen werden, liegt im Ermessen der Beamten vor Ort. Und genau diese Einschätzung kann auch beeinflussen, ob später die Frage aufkommt, wer zahlt Polizeieinsatz bei Ruhestörung, insbesondere wenn es um mögliche Gebühren für den Verursacher geht.
Mythos: Einmal im Jahr Party ist erlaubt?
Das Gerücht, dass jeder einmal im Jahr richtig laut feiern darf, hält sich hartnäckig. Das ist aber Quatsch! Es gibt kein Recht auf Ruhestörung. Auch bei der „einen Party“ müssen ab 22 Uhr die Zimmerlautstärke und die Nachtruhe eingehalten werden, es sei denn, alle Nachbarn stimmen ausdrücklich zu.[2] Eine Ausnahme bildet Silvester, da wird gesellschaftlich mehr Toleranz erwartet.
Konsequenzen und was du daraus lernen kannst
Wenn die Polizei wegen Ruhestörung gerufen wurde, kann das verschiedene Folgen haben. Im besten Fall bleibt es bei einer Ermahnung und die Ruhe kehrt ein. Im schlechteren Fall gibt es ein Bußgeldverfahren. Das Bußgeld wegen Lärmbelästigung kann, wie gesagt, empfindlich sein. Darüber hinaus kann ständige Ruhestörung auch mietrechtliche Konsequenzen haben, von einer Abmahnung durch den Vermieter bis hin zur fristlosen Kündigung im Extremfall. Wenn ein Mieter durch Lärmbelästigung einen anderen Mieter zur Mietminderung veranlasst, kann der Vermieter unter Umständen sogar Schadensersatz vom Störenfried verlangen. [3]
Man lernt also: Rücksichtnahme ist nicht nur eine Frage des Anstands, sondern kann auch handfeste finanzielle und rechtliche Vorteile haben. Die Frage, wer bei einem Polizeieinsatz die Zeche zahlt, sollte idealerweise gar nicht erst gestellt werden müssen, weil man es schafft, Konflikte vorher zu lösen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
Fazit: Wer am Ende für den Polizeieinsatz bei Ruhestörung aufkommt
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die direkten Kosten für den Polizeieinsatz wegen einer „normalen“ Ruhestörung trägt in der Regel die Allgemeinheit über die Steuern. Der Verursacher zahlt also nicht die Einsatzstunden der Beamten. Allerdings kann und wird bei festgestellter Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld verhängt, das den Störer finanziell trifft. Nur in Ausnahmefällen, bei besonders hartnäckigen, vorsätzlichen oder gewerbsmäßigen Störungen, kann es vorkommen, dass dem Verursacher auch Gebühren für den Polizeieinsatz direkt in Rechnung gestellt werden.
Das Thema Lärmbelästigung melden ist also vielschichtig. Der beste Weg ist immer, präventiv zu handeln: Kommunikation mit den Nachbarn, Einhaltung der Hausordnung und ein generelles Bewusstsein für die Bedürfnisse anderer. Denn auch wenn man meist nicht direkt für den Einsatz zahlt – der Ärger, die schlechte Stimmung im Haus und ein mögliches Bußgeld sind es sicher nicht wert. Die Frage, wer für den Polizeieinsatz bei einer Ruhestörung aufkommen muss, ist somit meist klar zugunsten des Steuerzahlers beantwortet, die Verantwortung für ein gutes Miteinander liegt aber bei jedem Einzelnen.
Quellen
- dpolg.de: Beteiligung Polizeikosten (abgerufen am 14.05.2025)
- arag.de: Ruhestörung: Was das Mietrecht zur Lärmbelästigung sagt (abgerufen am 14.05.2025)
- anwalt.de: ❯❯ Ruhestörung ᐅ In diesen Fällen sollten Sie zur Polizei! (abgerufen am 14.05.2025)
FAQs zum Thema Wer zahlt Polizeieinsatz bei Ruhestörung
Kann ich eine Ruhestörung auch anonym der Polizei melden?
Ja, prinzipiell kannst du eine Ruhestörung auch anonym melden, denn die Polizei ist verpflichtet, jedem Hinweis nachzugehen, um die öffentliche Ordnung zu sichern. Du musst also nicht unbedingt deinen Namen nennen, wenn du vielleicht Bedenken vor Reaktionen des Lärmverursachers hast. Allerdings kann es für die Beamten vor Ort manchmal hilfreich sein, einen Ansprechpartner zu haben, falls sie Rückfragen zur genauen Örtlichkeit oder Art der Störung haben. Zudem ist es für eine eventuelle spätere zivilrechtliche Auseinandersetzung oder als Zeuge natürlich immer besser, wenn deine Identität bekannt ist, aber für den reinen Polizeieinsatz zur Lärmreduzierung ist es zunächst nicht zwingend erforderlich. Bedenke jedoch, dass eine wissentlich falsche Meldung, auch wenn sie anonym erfolgt, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, falls sie aufgedeckt wird.
Welche Rolle spielt mein Vermieter, wenn ich ihm eine Ruhestörung durch andere Mieter melde?
Dein Vermieter hat eine sogenannte Fürsorgepflicht und muss dafür sorgen, dass du deine Wohnung vertragsgemäß nutzen kannst; dazu gehört auch der Schutz vor unzumutbarem Lärm durch andere Mietparteien im selben Haus. Wenn du ihn also über eine andauernde oder wiederholte Ruhestörung informierst, ist er in der Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese abzustellen. Dies kann beispielsweise eine Ermahnung oder im Wiederholungsfall eine Abmahnung des störenden Mieters sein. Dafür ist es sehr hilfreich, wenn du die Störungen genau dokumentierst, am besten mit einem Lärmprotokoll, das Datum, Uhrzeit, Art und Dauer des Lärms sowie eventuelle Zeugen festhält. Reagiert der Vermieter trotz deiner Meldung und ausreichender Beweise nicht oder nicht erfolgreich, könntest du unter bestimmten Umständen sogar die Miete mindern, solltest dich hierzu aber vorher unbedingt rechtlich beraten lassen.
Muss ich als Anrufer für den Polizeieinsatz zahlen, wenn sich herausstellt, dass vor Ort gar keine Ruhestörung (mehr) vorlag?
Normalerweise musst du dir keine Sorgen machen, dass du für den Polizeieinsatz zahlen musst, auch wenn die Beamten bei ihrem Eintreffen keine akute Ruhestörung mehr feststellen können. Schließlich kann es ja sein, dass der Lärm genau in dem Moment aufgehört hat, die Verursacher die Polizei bemerkt haben oder du den Lärm subjektiv als sehr störend empfunden hast, er aber objektiv unterhalb einer relevanten Schwelle lag. Die Polizei prüft die Situation nach bestem Wissen und Gewissen und wird nicht vorschnell Kosten erheben. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn du die Polizei wissentlich und grundlos alarmiert hast, also beispielsweise eine Ruhestörung nur vorgetäuscht hast, um jemandem zu schaden. In solchen Fällen des Missbrauchs von Notrufen oder einer nachweislich böswilligen Falschmeldung können dir die Kosten für den Einsatz tatsächlich in Rechnung gestellt werden und es könnten darüber hinaus weitere rechtliche Schritte folgen.
Was ist, wenn die Ruhestörung nicht von einem direkten Nachbarn, sondern zum Beispiel von einer Gruppe im Park oder auf der Straße ausgeht?
Auch bei Ruhestörungen, die von öffentlichen Plätzen wie Parks, Spielplätzen oder einfach von der Straße ausgehen, ist die Polizei dein zuständiger Ansprechpartner, denn es geht hier um die Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. Du kannst also auch in solchen Fällen die 110 wählen, um die Lärmbelästigung zu melden, besonders wenn es sich um nächtliche Ruhestörungen handelt oder der Lärm unerträglich wird. Die Beamten werden dann versuchen, die Verursacher vor Ort zu ermitteln und für Ruhe zu sorgen, beispielsweise durch Ermahnungen oder im äußersten Fall durch Platzverweise. Die Frage, wer für den Einsatz zahlt, bleibt hier im Grundsatz gleich: Solange es sich um einen normalen Einsatz zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung handelt, trägt die Kosten die Allgemeinheit. Ein Bußgeld kann den identifizierten Störern aber natürlich trotzdem drohen.